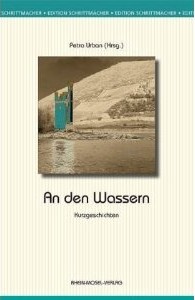|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
|
Froschperspektive
Letos Erwachen
Paulchen Cairo
|
|
|
|
Froschperspektive
Der Frosch war traurig.
Jahr ums Jahr saß er im Brunnen und wartete auf etwas, von dem er nicht wusste, was es war. Unterdessen trank er das kristallene Wasser und schaute den Luftblasen hinterher, die er ausatmete. Er wärmte sich in der Sonne, wenn sie am Tage schien und verkroch sich im weichen Schlamm, wenn er schlief in der Nacht.
Gelegentlich setzte sich ein seltsames Wesen an den Brunnenrand und sang oder kämmte sich die Haare – aber der Frosch wusste nicht, ob dies etwas mit ihm zu tun hatte. Er wusste eigentlich überhaupt nicht viel, nur dass er hier war und nicht nirgendwo. Insbesondere wusste er nicht, wer oder was er war. Hätte er es gewusst, wäre er vielleicht fröhlicher gewesen, aber so schien er unwissend wie der Tag oder die Nacht.
Einmal, als er gerade an gar nichts dachte, erschien eine goldene Kugel im Brunnen und sank taumelnd in die Tiefe.
Eiligst schwamm der Frosch hinterher und ergriff sie, bevor sie im Schlick zu verschwinden drohte.
Es war dunkel in der Tiefe des Brunnens, also schwamm er nach oben, und hielt die glänzende Kugel ins Licht. Was war das für ein komisches Ding? Wozu diente es?
Er brachte es näher an seinen Kopf und erschrak, denn ein riesiges Auge glotzte aus der Kugel, dass es ihm durch Mark und Bein ging. Was für ein Geist lebte wohl darin?
Der Frosch zwinkerte – der Geist zwinkerte zurück. Der Frosch zwinkerte abermals – der Geist zwinkerte ebenso. Jetzt zwinkerte der Frosch zweimal und der Geist in der Kugel antwortete mit zweimaligem Zwinkern.
Da ahnte der Frosch, dass er selbst dieser Geist war. Und er fand sich wunderschön und vollkommen – wie Gottes Ebenbild.
In diesem Moment ertönte eine Stimme: „Was tust du mit meiner goldenen Kugel, gib sie mir sofort zurück!“
Und der Frosch erkannte, welch große Unterschiede bestanden zwischen ihm selbst und dem Wesen, das er schon früher in der Nähe seines Brunnens gesehen hatte. Er bemerkte, dass der Prinzessin – denn um diese handelte es sich – vertrockneter Tang aus dem Kopf sprießte und dass sie hässliche kleine Schweinsäuglein hatte, die so ganz anders waren, als die geheimnisvollen Kugeln, die in seinem eigenen wohlgeformten Kopf saßen. Er betrachtete seine glänzenden, grünen Finger mit den herrlichen Schwimmhäuten dazwischen und verglich sie mit den weißen Ästen, die aus den Puffärmeln der Prinzessin wuchsen und er sah, dass sie drohend mit dem dürren Zweiglein wackelte, das einem der weißen Äste entsprang. Dieses Wesen dort war kein Frosch, sondern ein hässliches Menschlein, etwas, das getrennt war von ihm und allem, was ihn umgab.
Und ihre Stimme erklang wie Metall und sagte: „Her mit meiner Kugel, garstiger Frosch!“
„Hol sie dir, wenn du kannst,“ quakte er, von Ekel über jenes Unwesen geschüttelt.
Da wurde die Prinzessin sehr traurig, denn sie konnte nicht schwimmen. Mit hängendem Kopf ging sie von dannen.
Der Frosch lachte ihr quakend hinterher, doch fröhlich war er nicht.
Aber er hatte ja die goldene Kugel. Sie blitzte und blinkte und sein sich spiegelndes Auge schaute ihn an. Da verdoppelte sich seine Traurigkeit. Er versuchte, das Auge in der Kugel wegzudrehen. Doch so schnell er die Kugel auch drehte, das Auge blieb starr und vorwurfsvoll auf ihn gerichtet.
„Ich will die Kugel verstecken“, sagte er sich, „dann kann sie mich nicht mehr anschauen“.
Gesagt, getan. Er schwamm nach unten und vergrub sie im Schlamm unter den Wurzeln einer Wasserlilie. Doch fröhlich machte ihn das nicht.
Am nächsten Tag kam die Prinzessin wieder und rief: „Ach lieber Frosch, gib mir doch bitte meine goldene Kugel wieder, ich will dir Kleider und Schuhe geben, Perlen und Schmuck, selbst meine goldene Krone kannst du haben, wenn du willst.“
„Mit solch nutzlosem Tand kann ich nichts anfangen, schließlich bin ich ein Frosch, und selbst die Krone der Schöpfung.“
„Ich würde dich mitnehmen und an meinem Tisch essen lassen, wenn du mir meine Kugel zurückgibst“, sagte die Prinzessin, doch der Frosch lachte sie aus:
„Ich kann mir den Unflat schon vorstellen, von dem du dich ernährst, keine leckere Fliege, keinen glitschigen Regenwurm, keine einzige Webspinne würde ich kriegen bei dir, stattdessen verfaulte Milch und zerkochtes Fleisch – am Ende gar die Schenkelchen meiner Geschwister.“
„Ich würde dich mitnehmen und aus meinem Becher trinken lassen, wenn du mir meine Kugel zurückgibst“, sagte die Prinzessin, doch der Frosch lachte sie aus:
„Hier habe ich das reinste, kristallklare Wasser. Ich kann mir den Ekel schon vorstellen, den du durch deine Kehle rinnen lässt: gegorene Ausscheidungen, mit Hefen und Bakterien versetzte Essenzen, dass es einen nur so schüttelt.“
„Ich würde dich in meinem Bett schlafen lassen und mit dir kuscheln und dich küssen, wenn du mir meine Kugel zurückgibst.“
„Pfui“, sagte der Frosch, „in knisternd trockenen Tüchern müsste ich bei dir hocken, verzehrt von Hitze und erdrückt von deinen Zärtlichkeiten. Ich lebe hier im Paradies und du willst mich in die Hölle locken.“
Und palopp, war er im kĂĽhlen, schmeichelnden Wasser untergetaucht.
Am nächsten Tag kam die Prinzessin wieder und trug ein Netz und eine Harpune, eine Angel und ein Gewehr.
„Mein Vater sagt, ich soll mir nichts gefallen lassen – also, her mit der Kugel oder ich fange und töte dich.“
„Wenn du mich tötest, hast du gar nichts, keinen Frosch und keine Kugel,“ sagte der Frosch.
„Das ist mir egal“, sagte die Prinzessin und legte auf den Frosch an.
Der tauchte schnell unter und holte die goldene Kugel und warf sie der Prinzessin mit voller Wucht an den Kopf. Wie gefällt stürzte sie zu Boden und rührte sich nicht.
„Ah, ich habe sie erschlagen“, rief der Frosch und hüpfte aus dem Brunnen heraus, dass es nur so platschte.
Er sprang auf ihre Brust und fĂĽhlte, dass sie nicht mehr atmete.
Tief schaute er in ihre halb geöffneten Schweinsäuglein und seine Tat begann, ihn zu reuen.
Daher senkte er seinen breiten Mund auf die Lippen des Unwesens und begann zu blasen. Während er fühlte, dass sich dessen Brust hob und senkte, öffneten sich die Augen der Prinzessin, wurden groß und größer und schön und schöner. Es waren Froschaugen wie die seinen. „Ich muss doch einmal schauen, ob sie nun von alleine atmet“, dachte er und sprang von ihrer Brust. Und er sah, wie sie sich langsam in eine wunderschöne Froschprinzessin verwandelte.
Die beiden schauten sich lange an und dann gingen sie auf Hochzeitsreise. Die goldene Kugel aber warfen sie in den Brunnen, wo sie noch heute liegt.
Anmerkung: Diese Geschichte wurde im Rahmen eines Literatur-Wettbewerbs für eine Anthologie ausgewählt.
Zu bestellen bei amazon
|
 |
|
|
|
 |
 |
|
Paulchen Cairo
„Also ehrlich, dass in einem Krankenhaus-Café geraucht werden darf, ist doch echt das Letzte!“
„Ab ersten Juli ist Schluss damit!“
„Nein wirklich? Dann kann ich ja auf eine Beschwerde verzichten!“
Der Mann im grĂĽnen Anzug schob nach einem Blick auf die Rechnung einen Zehn-Euro-Schein unter den altertĂĽmlichen blauen Glasaschenbecher mit der Zigarrenwerbung und eilte seinem Freund hinterher.
Paulchen war entsetzt.
„Ist das wahr?“ flüsterte er und versuchte mühsam, zu der neben ihm stehenden Isidora Munkelmann hochzuschauen. Die kräuselte die Lippen und verdrehte die Augen. Dann näselte sie: „Das Rauchen in diesen Räumen wird strengstens verboten sein, wie unsereins es ja seit Anbeginn predigt, denn es schadet den Blumen und den Gardinen.“
„Und was wird aus mir?“
„Sie werden entsorgt! Sie sind gesundheitsschädlich, hässlich und hoffnungslos veraltet.“
Paulchen, der achteckige gläserne Aschenbecher, wollte eigentlich tief einatmen, kriegte aber keine Luft und produzierte stattdessen einen grauenvollen Husten, der an verrußte Lungen oder sterbende Asthmatiker erinnerte. Das war ihm noch nie passiert, obwohl Hunderttausende von stinkenden Zigaretten, Zigarren, Stumpen und Zigarillos in ihm ausgedrückt worden waren. Damit hatte er nie ein Problem gehabt – im Gegenteil, es entsprach seinem Lebensentwurf.
Ganz nebenbei nahm er Bonbonpapiere auf, Kaugummi, zerrissene Liebesbriefe, abgezählte Blütenblätter, Streichhölzer und Zahnstocher, Haarklammern, kaputte Gummibänder, verdrehte Büroklammern, Wattestäbchen und sogar verbrauchte Ohropaxe. Jeder dieser Gegenstände erzählte eine spannende Geschichte, wenn man nur zuzuhören vermochte. Auch Nasenpopel, ausgerupfte Nasenhaare, Grind, Fingernägel und sonstige menschliche Proben schluckte er ohne Murren – sogar ein gefülltes Kondom hatte mal jemand in ihm abgelegt.
Isidora Munkelmann hatte dieses Kondom nie vergessen, aber sie hätte sich eher den zierlichen Henkel abgebissen, als das zuzugeben. So etwas war undenkbar für eine klassizistische Vase.
Paulchen hingegen hatte dem Kondom stundenlang ein Loch in den Bauch gefragt, denn er interessierte sich brennend fĂĽr alle menschliche Themen.
Er liebte die Menschen, ihre Geschichten, Probleme und heimlichen Tätigkeiten. Das Krankenhauscafé war der richtige Platz für solche Vorlieben, hier ging es um fröhliche Geburten und Geburten mit Komplikationen, schwere Krankheiten, Pläne für die Zukunft oder bevorstehenden Tod.
Und damit sollte es nun zu Ende sein?
Paulchen wusste aus den vertraulichen Gesprächen im Café, was der Tod war – allerdings hatte er sich nie Gedanken gemacht, dass es ihn auch selbst betreffen könnte.
Was würde passieren, wenn man ihn „entsorgte“, wie Isidora sich ausdrückte? Trat der Tod schon ein, wenn man in den Tiefen eines Glascontainers verschwand, oder erst, wenn man eingeschmolzen wurde? Verließ die Seele den Körper als Einheit, oder wurde sie in kleinste Teilchen zerlegt, die wie Einzeller mit Flügeln durch die Welt flatterten, um irgendwann wieder zusammengesetzt zu werden?
„Du wirst es bald erleben“, sagte Isidora, „man wird dich auf einem Lastwagen voll Schutt und Unflat auf den Müllplatz fahren!“
Hatte er laut gesprochen? Wie peinlich.
„Was macht Sie so sicher, dass Sie nicht auch auf diesem Müllplatz landen?“
„Ich doch nicht“, entgegnete die Vase und reckte sich hoch über die Tischplatte, „ich bin eine echte KPM, wohingegen Sie nur ein hundsgemeiner Reklame-Aschenbecher sind, ein Werbegeschenk. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass man Sie so lange in diesem Etablissement geduldet hat.“
Paulchen schluckte. Wie oft hatte er solche Sprüche hören müssen! Ich bin von königlichem Geblüt, handgefertigt in der Königlichen Porzellan-Manufaktur zu Berlin.
Mitglieder des Adels – teure Pillendosen, goldene Feuerzeuge, lederne Zigarrenetuis – hatten ihm zugeraunt, dass Isidora in Wirklichkeit eine plumpe Nachahmung war, wohingegen es sich bei ihm immerhin um einen echten Die gute Cairo handelte, ein wertvolles Sammlerstück. Doch solche Versicherungen konnten sein Selbstbewusstsein nicht stärken. Tja, wenn er wenigstens ein bisschen Adel besessen hätte – wie der Lord Extra vom Tisch nebenan ...
Einmal hatte sich eine laszive Handtasche von Louis Vuitton in ihn verliebt: „...Und kam sie in Ekstase, dann schob sie auch den Leuchter nach – der war aus blauem Gla-a-se.“ hatte sie gesungen, bevor man sich schluchzend trennte. Niemals würde er ihren Duft nach Parfum und Leder, nach frischer Seebrise auf Kreuzfahrtschiffen, nach Pferdeturnieren und Autorennen vergessen. Seine Sehnsucht nach solchen Abenteuern wuchs und wuchs – doch näher und näher rückte der Tag, an dem all dies nicht einmal mehr gedacht werden konnte.
Renate Lebwohl und ihre Freundin Doris saĂźen schon eine ganze Weile an Paulchens Tisch und unterhielten sich ĂĽber Renates Mann.
„Er müsste nur abnehmen und den Alkohol reduzieren, dann bräuchte er nicht hier sein“, klagte Renate und Doris fügte hinzu: „und das Rauchen einstellen!“
Paulchen zuckte zusammen.
„Da hast du recht“, sagte Doris und schaute auf die Uhr. „Oh, ich müsste längst zu Hause sein!“
„Ich auch!“
„Ich müsste vor allem mal nach Pünktchen schauen!“
„Ach Gottchen, sitzt die etwa im Auto?“
„Sie hat bestimmt Durst.“
„Bring ihr halt ein bissel Wasser! Hier nimm den Aschenbecher!“
Doris schaute sich um und flüsterte: „Das kann ich doch nicht machen!“
Sie stand auf und ging zu der reizenden alten Dame hinterm Tresen. Nach einer Weile kam sie lachend zurĂĽck.
„Stell dir vor, ich soll nicht nur, wie du gesagt hast – den Aschenbecher nehmen – sondern brauche ihn auch nicht zurückbringen. Ab ersten Juli ist das Rauchen im Krankenhauscafé untersagt und dann wird das Teil nicht mehr gebraucht.“
„Na prima!“
Doris fĂĽllte Paulchen mit frischem Wasser und deponierte es im Kofferraum ihres Autos. Die Frauen ratschten noch lange weiter, und Isidora verdrehte gelangweilt die Augen.
Paulchen freundete sich unterdessen mit Pünktchen, der Chi-hua-hua-Dame an. Die setzte später bei ihrer Dienerin Doris durch, dass Paulchen als Trinkgefäß stets mitgeführt werden musste. So fuhr er im Auto herum und sah eine Menge von der Welt, die er bisher nur aus Erzählungen kannte.
Zusammen mit seiner neuen Freundin besuchte er Autobahnparkplätze, Schrebergärten, Vergnügungsparks und Jahrmärkte. In einem Biergarten bot ein Sammler eine Menge Geld für ihn, aber Pünktchen protestierte so lautstark, dass das Geschäft nicht zustande kam. Auf einem Friedhof wurde ein anderer Sammler beim Versuch, ihn zu stehlen, von Pünktchen gebissen und von Doris ins Krankenhaus gefahren. Dort fragte er nach der Vase Isidora Munkelmann und musste erfahren, dass man sie im Zuge der Renovierung des Krankenhauscafés in einem Müllcontainer entsorgt hatte.
Das machte ihn aber ĂĽberhaupt nicht traurig.
Wilfried von Manstein
Anmerkung: Diese Geschichte entstand im Seminar “Kreatives Schreiben” an der Internationalen Hochschule Calw. Sie wurde für den Putlitzer-Preis 2007 nominiert.
|
 |
|
|
|
 |
 |
|
Letos Erwachen
Langsam taucht Leto aus den Nebeln des Vergessens auf. Endlose Weite, Niemandsland.
Eine sich in die Unendlichkeit erstreckende, weiße Ebene. Nichts zu sehen, nichts zu fühlen, nichts zu hören. Oder doch etwas zu hören? Erklang da soeben ein metallenes „Ping“ in der Ferne?
Erwachte er gerade aus einer tiefen Narkose? Einem Koma?
Seine Augen fahnden innen nach einem Anhaltspunkt. Bunte Kreise, Spiralen, zwei Sonnen, die unscharfen Augen einer phantastischen Eule, verschwimmende Formen.
Wieder das „Ping“. Warnton eines Gerätes auf der Intensivstation?
Irgendwann versucht er einen Muskel zu rühren, irgendeinen. Er kann sie alle vor seinem geistigen Auge sehen, denn als Krankenpfleger kennt er sich aus mit Anatomie. Aber es gelingt ihm nicht. Nicht einmal die Lippen kann er verziehen oder die Augäpfel verdrehen. Ist er gefangen im Locked-In-Syndrom? Ist er tot für seine Umwelt, nicht mehr fähig zu signalisieren, dass er noch da ist?
Ach natürlich, er träumt, ist doch klar.
Nach Stunden oder Tagen weiĂź er, dass dies kein Traum ist.
Er beginnt, seine Innenwelt zu erforschen und findet nur Gedanken, Vorstellungen, Traumbilder.
Er sieht wieder den Nervenarzt, der ihn, als er vierzehn war, fragte, ob er onaniere. „Ich weiß nicht wovon Sie sprechen!“ Ungläubiger Blick des Arztes. Schuldbewusstsein und nicht wissen, wofür und warum. Der Arzt gibt ihm ein Buch, in dem genau beschrieben ist, welche der schädlichen Praktiken man besser nicht ausüben sollte.
In der nächsten Szene sitzt er auf dem heruntergeklappten Toilettensitz und probiert, was da so genau beschrieben ist. Nach fünf Minuten hat er seinen ersten Orgasmus und fällt fast vom Klo. Welches unbekannte Land hatte sein Geist soeben für einen Moment betreten? Er schaut in den Spiegel, in seine tiefen, dunklen Augen – und findet keine Antwort. Aber er wird es herauskriegen. Von nun an tut er es jeden Tag.
Später gibt es andere Methoden, um das Unbekannte, Neue zu spüren: Drogen, heftiges Atmen, Frauen.
Da ist das fremde Mädchen in der Straßenbahn. Ein feuriges Band scheint zwischen ihnen zu zucken, es zieht und wabert, er kann seinen Blick nicht von ihr lösen und sie nicht von ihm. Er folgt ihr in ihre kleine muffige Wohnung. Sie entkleidet sich und liegt ganz still und er ist über ihr und starrt ihr immer weiter in die Augen bis er nicht mehr kann und schweißüberströmt auf ihr zusammenbricht.
Einmal hat er zu viel Gras geraucht und sich eingebildet, er müsse ersticken. Er rennt. Das alte Krankenhaus aus rotem Backstein steht hoch auf einem Berg und er rennt um sein Leben diesen Berg hinauf und wundert sich, dass er so rennen kann. Er sagt dem Notarzt, er könne nicht verraten, was er eingenommen habe, aber er wisse genau, dass er ersticken müsse. Dabei ist sein Hals völlig frei und plötzlich hat er einen Lachanfall, der gar nicht mehr aufhören will. Seinen Namen will er nicht sagen, aus Angst vor der Polizei und der Arzt übergibt ihn der Nachtschwester. Die legt ihn in ein Bett auf dem Gang und grinst, denn sie weiß genau, was mit ihm los ist. Er versinkt in wirre Träume.
Ohne jedes Zeitgefühl treibt er jetzt im Universum seines eigenen Bewusstseins, abgeschnitten von jeder Kommunikation. Wenn er doch nur ein Lebenszeichen von einem anderen Wesen bekäme. Selbst ein Tier oder eine Pflanze hätte er auf virtuellen Knien begrüßt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreit er mit der Intensität einer gequälten Seele. Er erhält keine Antwort, bleibt allein in seiner einsamen, persönlichen Hölle.
Irgendwann merkt er, dass seine Gedankenimpulse zurĂĽckgeworfen werden. Er schickt sie erneut aus, bekommt ein GefĂĽhl dafĂĽr, was tief aus seinem eigenen Hirn stammt und was Echos von weiter drauĂźen sind.
Die gedankliche Umgebung nimmt Konturen an, er beginnt, sich ein Bild von ihr zu machen. Er muss mit einem Computer verbunden sein. Das schlieĂźt er aus der Tatsache, dass manche seiner Fragen beantwortet werden. Er kann Fragen in verschiedene Richtungen schicken, durch Kupferleitungen, in Glasfaserkabel, ins Internet. Die Bahnen, auf denen sich diese Impulse bewegen, macht er zu einem Teil seines Gehirns, er dehnt es aus, so weit er kann. Bald vermeint er, das Universum auszufĂĽllen, aber es bleibt ein totes, ein kĂĽnstliches Universum.
Er fragt: „Wo bin ich?“
Eine quäkende Computerstimme antwortet: „Dreiundvierzig Komma vier sieben Grad nördlicher Breite, fünfundsiebzig Komma eins null Grad westlicher Länge.“
Damit kann er nicht viel anfangen.
„Wer bin ich?“
„Ausstellungsobjekt siebenundsechzigtausendfünfhundertvierundvierzig Strich Null Null Neun.“
Nach einigen erfolglosen Versuchen gelingt es ihm, seine eigene, auf entfernten Festplatten gespeicherte Krankenakte zu lesen. Und er findet weitere schockierende Unterlagen. Er liest, dass sein Gehirn im Jahr 2030 nach jahrelangem Koma entnommen und zu Versuchszwecken mit einer Apparatur verbunden wurde, die es mit Sauerstoff und allen nötigen Nährstoffen versorgt. Die Versuchsanordnung erprobte Gehirn-Computer-Schnittstellen, die man für Querschnittsgelähmte einzusetzen hoffte. Niemand ahnte zu jener Zeit, dass es in ihm noch ein schlafendes Bewusstsein gab, das irgendwann wieder aufwachen würde.
Die jungen Wissenschaftler erzielten erstaunliche Ergebnisse, wurden mit Preisen überhäuft und ihre mustergültige Versuchsanordnung landete in einem Museum. Die Besucher konnten auf Knopfdruck das lebende, wenn auch bewusstlose Gehirn auf dem Bildschirm eines Tomographen sehen und seine Interaktion mit mehreren Computern beobachten. Daher die Versorgung mit Energie, daher die Nährstofftanks, der Sauerstoff, die gleichmäßige Temperatur der Nährlösung. Daher auch die Verbindung mit dem damaligen Internet – der Versuch konnte von jedem Punkt der Welt aus abgerufen und beeinflusst werden. Millionen von Menschen hatten per Mausklick sein Gehirn gereizt und beobachtet, was die damit verbundenen Maschinen daraufhin taten.
„Welches Datum schreiben wir?“
„Dreizehnter Dezember ZweitausendsiebenÂhundertzweiundvierzig.“
Leto verwandte die nächsten Jahre darauf, Kontakt mit der Menschheit aufzunehmen. Ohne Erfolg. Entweder war sie der Klimakatastrophe zum Opfer gefallen oder hatte sich selbst ausgerottet oder das veraltete Netzwerk, an dem er angeschlossen war, hatte keine Verbindung mehr mit den Kommunikationssystemen einer modernen Zivilisation – wenn sie denn existierte. Zunächst war es ihm hauptsächlich ums Überleben gegangen, er musste Angst haben, dass man ihm den Saft abdrehte, dass sein Sauerstoff eines Tages zu Ende sein würde. Dann kam die Phase, in der er sich den endgültigen Tod wünschte. Doch er blieb wo er war und was von ihm lebte, lebte weiter. Keine Gehirnzelle war abgestorben, im Gegenteil, er fühlte, dass sein Hirn besser funktionierte als je zuvor. Möglicherweise war es gewachsen, hatte neue Synapsen gebildet, hatte Teile seiner selbst mit anderen Teilen verbunden, die vorher nichts voneinander wussten.
So, wie ein Erblindeter nach kurzer Zeit den akustischen Sinn schärft und aus der eingeschränkten Wahrnehmung seiner Ohren ein funktionierendes Modell der Umwelt baut, so gelang es ihm bald, in seiner Phantasie zu existieren, als wäre sie die Realität. Letos Leben war ein immerwährender Traum, in dem er immer öfter vergaß, dass er nur ein Geist in einem Gehirn war. Aber irgendwann wurden ihm die eigenen Träume langweilig und er suchte nach Anregungen von außen. Auf den Rundflügen durch seine virtuelle Umgebung entdeckte er digitale Bibliotheken, mit Büchern aus den Jahren, als er noch seinen Körper benutzte. Manche dieser Bücher schufen nur neblige, verschwommene Welten, andere ließen solide Strukturen entstehen, Farben, Formen, Töne, Musik, ganze Symphonien von Gerüchen, Geschmäckern und Ausdünstungen aller Art.
Mit Jean-Baptiste Grenouille in „Das Parfum“ roch er den Verwesungsbrodem des Pariser Viktualienmarktes, mit Hannibal Lecter war die Welt voller Gerüche, die wie Farben in die Luft gemalt sind. Auf einer Flugreise öffnete Lecter voller Genuss eine Schachtel mit Brot eines Pariser Delikatessenhändlers, mit Trüffeln, „Pâté de foie gras“ und anatolischen Feigen, die noch von ihren harten Stielen weinen.
Ein Titel hatte ihn magisch angezogen, drückte er doch haargenau sein Empfinden aus, seine Sehnsucht, seine Einsamkeit, seine Jagd und das Gefühl, dass nicht sein denkendes Gehirn ihn am Leben erhielt und motivierte, nicht zu verzweifeln, sondern sein Herz, auch wenn er keines mehr besaß. Das Buch hieß: „Das Herz ist ein einsamer Jäger“.
Er liest es zum fĂĽnften oder sechsten Mal.
Er sitzt in Biffs Restaurant und beobachtet Baby mit ihrem Kopfverband, den sie trägt, weil Bubber ihr aus Versehen ein Loch in den Schädel geschossen hat. Baby ist unausstehlich, Lucile beschwert sich über sie und Biff sagt zu Lucile: „Hör auf damit, an ihr herumzunörgeln, dann ist sie ganz in Ordnung“. Biff stopft Baby ein Gummibonbon in den Mund, zieht ihre Schärpe zurecht, klopft ihr liebevoll aufs Hinterteil. Schließlich bringt er die beiden ganz in Letos Nähe unter, in der Fensternische. Leto spürt den Luftzug, als Biff an ihm vorbeigeht, riecht das Parfüm seiner verstorbenen Frau. Wundert sich, dass Biffs Bartstoppeln genau so bläulich schwarz schimmern, wie er es sich vorgestellt hatte, als er das Buch zum ersten Mal las. Er bemerkt, dass auch Jake Blount immer wieder ungläubig schnuppert, wenn Biff an ihm vorbeitänzelt. Singer und Blount sitzen an ihrem Tisch, Blount isst mit Behagen und redet sein übliches verrücktes Zeug, der Taubstumme hört höflich zu. Nebenan mümmelt Baby die feingeschnittene Hühnerbrust in sich rein und Lucile stochert auf ihrer Spezialplatte herum.
Biff steht hinter der Theke und geht seiner LieblingsÂbeschäftigung nach: Er beobachtet die Gäste. Leto fĂĽhlt jeden seiner Gedanken, sieht jedes Bild: lauter essende Leute. Weit aufgerissene MĂĽnder, in die das Essen hineingestopft wird. „Leben heiĂźt nichts wie Essen und Trinken und Fortpflanzung“. Wo hat Biff das wohl gelesen? Leto muss virtuell lachen, fĂĽr ihn ist Leben ... was kann er sagen?
Schade, dass er nur Gast ist in diesem Roman, die Zeit gefällt ihm, die Leute, besonders die frühreife Mick hat es ihm angetan. Leider kommt sie heute nicht. Soll er jetzt mit dem müden Biff rausgehen? Er weiß, auch der liebt Mick auf seine verquere Art. Er wird um ihr Haus schleichen, wie jeden Sonntag seit vier Wochen, aber er wird sie nicht zu Gesicht bekommen und er wird darüber nachdenken, was er ihr schenken kann und er wird ein Fünfcentstück im Rinnstein finden und es sauberputzen und einstecken. Obwohl der taubstumme Singer ihm am liebsten ist, weiß Leto doch, dass er mit dem ein bisschen unsympathischen Biff die größte Ähnlichkeit hat: Was wusste er? Nichts. Was war sein Ziel? Es gab keines. Was wollte er? Erkennen. Was erkennen? Einen Sinn. Warum? Ein Rätsel. Das sind Biffs Gedanken im Buch und das sind Letos Gedanken in dem, was er nun sein Leben nennt. Aber hatte Leto die gleichen Antworten wie Biff?
Er spürt, dass Fragen das Beste sind, das man sich und anderen antun kann. Fragen und auf die Antwort des Herzens warten. Sich selbst fragen. Denn die Antworten der Anderen, was nützten sie ihm? Insofern ist es gar nicht so schlecht, dass er jetzt völlig auf sich gestellt ist. Eines wundert ihn: die Liebe fehlt in Biffs Gedanken. Stellt er die Frage nach der Liebe nicht, weil er darin schwimmt? Weil er von Menschen umgeben ist, die er auf seine Art so sehr liebt, dass es wehtut?
Noch immer war Leto von dem unbändigen Drang beherrscht, Kontakt mit Menschen zu haben, auch wenn sein Verstand längst akzeptiert hatte, dass es keinen geben würde.
Ja, er hatte versucht, mit den Figuren seines Lieblingsromans zu interagieren, er hatte in Biffs Café randaliert, geschossen, hatte auf der Straße wildfremde Frauen geküsst, hatte sich zu Singer an den Tisch gesetzt und ihm im Gesicht rumgefummelt – bei ihm hatte er sich die größten Chancen erhofft, wahrgenommen zu werden – aber es erfolgte nicht die geringste Reaktion. Er ging wie ein Nebel durch die Menschen hindurch und sie durch ihn. Dennoch tat er so, als würde er dazugehören. Es gab ihm ein gutes Gefühl, ließ ihn über lange Zeiträume hinweg vergessen.
Er gewöhnt es sich an, gelegentlich in Biffs Restaurant zur Toilette zu gehen, weil er das frĂĽher immer so machte. Im GegenÂsatz zu seinen Frauenbekanntschaften, die regelmäßig nach Verlassen eines Lokals quengelten, sie mĂĽssten mal dringend.
Als er wieder zurückkommt, sitzt dort eine Frau – nein, fast ein schlaksiges Kind – mit Ponyfransen, einem ausdrucksvollen rotgeschminkten Mund, riesigen kaffeebraunen Augen. Fast erinnerte sie ihn an Mick. Sie starrt ihn an, er starrt zurück.
War dieser Blick belustigt oder traurig? GĂĽtig oder zynisch? Sah er sie oder sich selbst gespiegelt? War die Frau eine bisher unbekannte Figur des Romans oder wie er ein Besucher? Eine Leserin?
Das Stimmengewirr im Restaurant vermischt sich zu einem gleichmäßigen Rauschen, die Bewegungen, die er im Augenwinkel unscharf wahrnimmt, verschwimmen zu einem Ballett der Formen, wie die Blättern eines Baumes im Wind. Maße werden relativ. Die Konturen ihres Gesichts beginnen zu leuchten und verschieben sich zitternd gegeneinander. Das Gesicht ist alt, das Gesicht ist jung. Zeitlos. Er sieht Hexen, Totenköpfe, Vögel, weise alte Männer, lüsterne junge Mädchen, alles in immer schnellerer Folge. Er will eigentlich sprechen, aber je länger dieser Blick dauert, um so unpassender und unmöglicher scheint das.
Doch dann, ganz unvermittelt, spricht sie zu ihm, so dass er zusammenzuckt: „Willkommen in meinem Roman. Ich habe ihn für Sie geschrieben. Aus Liebe.“
Leto ist erstaunt, dass er weinen kann.
Anmerkung: Die Geschichte wurde geschrieben für den Münchner Menüwettbewerb, der unter dem Motto “Das Herz ist ein einsamer Jäger” stand.
|
|