|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
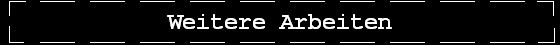 |
|
|
|
|
|
|
|
Stuttgarter Spuren
Die Verwandlung des Murat K.
Carson McCullers: „Die Autobiographie“
|
|
|
Spuren
Im Stuttgarter Zahnradbahnhof hat das „Theater Rampe“ seine Spielstätte. Eine strahlende, südamerikanisch wirkende Schönheit gibt die Karten für die Veranstaltung aus. Heiße Luft bläst von irgendwo darüber und erwärmt die Bahnhofshalle. In der Toilette stelle ich fest, dass mein Urin knallrot verfärbt ist. Mit dem Handy rufe ich meine Freundin an, die zwar Krankenschwester, aber nicht zu erreichen ist.
In der Cafeteria gibt’s einen guten Latte macchiato, mein Studienkollege bringt dem Hungrigen eine Schnecke aus einer Bäckerei in der Nähe – die Stimmung ist ein wenig entspannter nach dem hektischen Nachmittag in der Hochschule, von der man immer noch nicht weiß, ob sie wirklich eine ist.
Ich blättere im aus drei fotokopierten DINA4-Seiten zusammengehefteten Programmheft zu „Große Szene am Fluss“. Darin der Prolog zu diesem Einakter, ein Gedicht, in VERSALIEN WIE IN STEIN GEHAUEN DIE ZEILEN NICHT IMMER SINNVOLL UMBROCHEN. NUR EIN EINZIGER PUNKT IRGENDWO UND DANN AM ENDE NOCH EINER. Große Theaterkunst erwartet mich also. Aber vorher wird der große Dramatiker zum Podiumsgespräch erscheinen.
Ein Podium gibt’s jedoch nicht, auch keine erhöhte Bühne. In einem ganz in schwarz gehaltenen Raum mit ansteigenden Stuhlreihen ist gelber Sand gestreut, abgeteilt durch drei in alten Autoreifen montierte schiefe Äste, die mit rotweiß gestreiftem Plastikband verbunden sind. Vier Stühle auf Sand gestellt – die Intendantin, der Dramatiker, die „Mitarbeiterin“ des Dramatikers und der Regisseur nehmen Platz.
Der Dramatiker will geliebt werden, er freut sich über Preise und vor allem darüber, dass das Theater eine wichtige Position im Leben der Stuttgarter Zuschauer einnimmt. (Man macht sich gerne was vor.) Die Intendantin mit der kratzigen Stimme fragt den Dramatiker, was er meint, wenn er einst sagte: „Die Spur der Literatur darf auf der Bühne nicht mehr sichtbar sein.“ Der Dramatiker kann sich an diesen Ausspruch nicht erinnern, aber er erläutert, dass der Text für die Theatermacher ein Material ist wie die Schauspieler oder das Bühnenbild.
(Waren im Sand auf der Bühne Spuren zu sehen? Ich habe nicht darauf geachtet, wie auf so vieles nicht. Die sich wiederholenden deutlichen Spuren des Blutes in meinem Urin beschäftigten mich.)
Die Partnerin des Dramatikers erzählt, wie die Zusammenarbeit mit ihr als „Versuchskaninchen“ begann und wie sie heute aussieht: Gespräche, auch mal ein Streit mit anschließender Versöhnung (Lachen) – das ist nur möglich, weil die Mitarbeiterin nicht auf eigenen Ruhm als Dramatikerin aus ist.
Der Dramatiker antwortet auf die Frage, wie er seine Stoffe finde, dass ein Problem ihn „treffen“ müsse. Dann erzählt er von seinem ersten Stück „Die Kurve“, das entstand, weil er mit seiner Vespa in einer Kurve verunglückte und das Zadek mit Kinski und Qualtinger verfilmte. Mir wird klar, dass dieser Dramatiker mich schon mein ganzes Leben lang verfolgt: In der Schule musste ich seine Stücke lesen, an diversen Theatern, an denen ich arbeitete, wurden sie gespielt. In neun Tagen wird er fünfundachtzig. (Er sei auch nicht ganz gesund, wird gemunkelt.)
Das Stück, das wir heute sehen werden, entstand während des Balkankrieges; der Dramatiker sagt dazu: „Man fängt Partikel auf aus der Realität und wenn es mehr werden, versucht man, sie in eine Ordnung zu bringen und so fängt ein Stück an zu entstehen, manchmal bleibt es auch liegen, natürlich.“ Zadek hat zum Dramatiker, mit dem er sehr oft zusammenarbeitete, gesagt: „Gib mir deine erste Fassung, die ist noch unordentlich, chaotisch.“ „Spätere Fassungen werden ordentlicher, aber auch konventioneller“, sagt der Dramatiker. Der sprachlich ungeübte Regisseur zitiert ihn so: die Geschichte eines Stücks müsse immer auf eine Briefmarke passen. Der Dramatiker hat den Satz von einem australischen Kritiker übernommen, der damit den Inhalt des Stücks „Eiszeit“ kritisieren wollte, für den Dramatiker war das eine positive Bemerkung. (Ich denke an Lajos Egris „Prämisse“, die grundlegende Aussage, die jedes gute Theaterstück haben muss.) Der Dramatiker sagt: „Man muss die Quintessenz einer Geschichte in ein oder zwei Sätzen festhalten, das ist während der Arbeit am Stück ein guter Haltepunkt.“
Die Intendantin mit der kratzigen Stimme fragt den Dramatiker, warum ihm die Stuttgarter Inszenierung des nicht häufig gespielten Stücks so gut gefallen habe. „Warum?“ fragt der Dramatiker und das Publikum lacht. „Es hat drei sehr gute Schauspieler, die sich die Geschichte ,angeeignet’ haben und der Regisseur hat das Stück mit seiner strengen Dramaturgie sehr gut inszeniert.“
Die Intendantin mit der kratzigen Stimme fragt den sprachlich ungeübten Regisseur: „Was ist das Aktuelle für Dich an dem Stück?“
Der sprachlich ungeübte Regisseur antwortet: „Ja die Aktualität ist das Eine – das Andere ist dass das Stück einfach wahnsinnig dicht geschrieben ist und die Figuren einfach – ja – äh – mich bewegen und äh ja auch irgendwo jede Figur ihre eigene Glaubwürdigkeit besitzt äh und dass das Ganze dann in der Verkettung der Umstände umso schlimmer macht äh – also von daher finde ich das Stück eigentlich – äh hat auch eine – zeitlose Qualität äh – die ja auch denke ich beabsichtigt ist äh es ist ja als Ort äh ganz äh explizit ein Kriegsschauplatz angegeben und auch im Stück geht’s jetzt nicht daraus hervor dass das jetzt unbedingt äh Balkan sein muss äh – ja ich hab das eben nicht zur Entstehungszeit äh äh entdeckt das Stück sondern erst später und zwar eben in den Jahren als es im Irak dann so langsam richtig rund ging und äh dann hat’s mich eben auch wie die Faust aufs Auge getroffen äh weil ich mich äh – mit der Situation im Irak äh sehr intensiv beschäftig hab’ und eben auch dann auf diese Aktualität äh der Verschärfung des äh internationalen Söldnertums äh äh gestoßen bin und das natürlich mit dem Stück dann wunderbar in Verbindung gebracht habe – äh – und das hat mich einfach auch äh schockiert äh …“ undsoweiter undsoweiter.
Als theaterabstinenter ehemaliger Theatermensch, der seinerzeit zunehmend frustriert war vom Stumpfsinn der Schauspieler, Autoren und Theaterbesucher beginne ich, mich auf die kommende Aufführung zu freuen. Ich erinnere mich an meinen Freund, den Dichter Christoph Derschau, der in den Siebzigern eine Podiumsdiskussion auf die Bühne gebracht hat, von der man nicht glaubte, dass sie inszeniert war und dass es sich um Schauspieler handelte, die lediglich Texte gelernt hatten. Den sprachlich ungeübten Regisseur könnte man als hervorragenden Schauspieler genießen, wenn man wüsste, dass er einer ist, aber leider weiß man ja, dass er kein Schauspieler, sondern ein ganz jämmerlicher ungeübter Sprecher ist, dem man das Wort verbieten müsste, aber das traut sich ja keiner, da sitzen sie zehn Minuten lang und gucken verständnisvoll und versuchen diese Platitüden zu verstehen. Ich muss pinkeln und gehe raus und da ist wieder das Blut und ich bin sicher, dass es sich um Blasenkrebs oder Prostatakrebs oder Harnröhrenkrebs handelt und meine Krankenschwester geht immer noch nicht ans Telefon und ich vergesse meine Wasserflasche auf dem Klo so dass ich nochmal reingehe und da ist die Tür verschlossen und ich rufe rein und frage den armen Menschen, der da auf der Kloschüssel hockt, ob er eine Flasche hinter sich auf dem gemauerten Podest sieht, hoffentlich ist es kein alter Mann, der sich den Rücken verrenkt, wenn er sich so umdreht während er scheißt und er sagt, da ist keine Flasche. Also habe ich Flasche die Flasche im Theatersaal liegen lassen aber da will ich nicht nochmal reingehen und dann höre ich über Lautsprecher, welche Erleichterung, den Applaus, der, was mich beträfe, wenn ich noch im Saal wäre, ein Applaus wäre aus Freude, dass diese grauenhafte Demonstration von Mittelmaß endlich vorüber ist.
Ich schwimme gegen den Strom der Besucher in den Saal, zu meiner Wasserflasche und suche mir einen allerbesten Platz ganz vorne in der Mitte der ersten Reihe, trinke einen Schluck und bringe einen halbnackten Mann, der die BĂĽhne gerade in diesem Moment von der Seite betreten will, zum abrupten Innehalten. Ein Schauspieler. Beim Rausgehen sehe ich, wie auf einer Empore eine Projektion eingerichtet wird.
Nach einer Pause strömt das Publikum wieder in den Saal. Der weißhaarige Dramatiker sitzt neben mir, zwischen uns ist aber ein freier Platz, was mir ganz recht ist. Ich beuge mich zu ihm und bitte ihn im Voraus um Entschuldigung dafür, dass ich möglicherweise während der Aufführung den Saal kurzfristig werde verlassen müssen – „Sie verstehen, die Prostata“. Er nickt verständnisvoll und stützt sich auf seinen Spazierstock mit dem geschwungenen silbernen Knauf. Nach der Aufführung, die er gebannt verfolgt, wird er sich seinerseits während des Applauses an mich wenden: „Na, Sie sind ja sitzen geblieben!“ Ich: „Ihr Stück war stärker als meine Prostata.“
Ich muss sagen, es hat mich gut unterhalten. Die beiden Söldner sind witzig angezogen, Hosen aus Tarnstoff, der Oberkörper nackt, übergeworfene Mäntel. Der Reporter, im hellen Anzug, trägt vor der Brust eine Kamera, deren Life–Bilder wie ein Film auf die große und helle Projektionsfläche geworfen werden. Erstaunlich die Ästhethik dieser Bewegung, erstaunlich auch, dass der Reporter die Szene stets scheinbar mühelos im Bild einfängt, wobei die Söldner perspektivisch gestaffelt zu sehen sind. Das ist genial. Die Darsteller spielen virtuos mit ihren Klamotten, mit dem Sand, mit der Schnur an der Kamera; die Sprache ist beste Theatersprache; die Spannung wird gehalten; es gibt eine Steigerung. Der Reporter interessiert sich für die Geschichte vom Tod des Kameraden der beiden Soldaten, von denen der eine aus dem Westen, der andere aus dem Osten kommt. Auf dem Plakat zur Aufführung stand: „Habt ihr Harko gekannt?“ Diese Frage, mit der das Stück beginnt, enthüllt von Szene zu Szene das ganze Drama des blutigen Krieges. Wurde Harko von seinen eigenen Kameraden hingerichtet, weil er das Gesetz des „anständigen“ Krieges verletzt hat? Oder wurde er vom Feind aus dem Hinterhalt erschossen? Und spielen Speed und Osso, die beiden Söldner, ein böses Spiel, um den Journalisten Budd, der sich von ihnen eine gute Story erhofft, zu täuschen und die ganze Kriegskolportage als Schwindel zu entlarven? Als Ort der Handlung dient „Ein Kriegsschauplatz“. In seinem Prolog „Die andere Aeneis“ deutet Tankred Dorst an, wo man(n) diesen Kriegsschauplatz findet: am Fluss des Vergessens. Das würde bei sehr kleiner Schrift auf eine Briefmarke passen. Der Text stellt allerdings lediglich Fragen und ist keine Synopsis, wie es fälschlich auf einer Reklame-Website zum Stück heißt.
Wozu musste ich mir das eigentlich ansehen? Weil ich endlich verstehen sollte, dass Krieg Scheiße ist? Dass Kriegsberichterstattung Scheiße ist? Dass im Krieg schlimme Dinge passieren? Dass der Mensch böse ist?
Ich frage mich: Hat sich etwas verändert, seit ich mich vom Theater abwandte? Nein, es immer noch nichts als Unterhaltung für eine Minderheit. Für ein paar Leute, die schon alles wissen, sich nicht verändern, zu viel Zeit und Geld haben, für Scheintote. Ich gehöre dazu. Leider.
Ach Unsinn, ich habe es angeschaut, weil es zu meinem Unterricht gehört. Weil ich „Literarisches Schreiben“ studiere, an einer Hochschule, von der man nicht weiß, ob sie eine ist. Jetzt – vierundzwanzig Tage später, ist der literarische Inhalt des Stücks bereits dem „Fluss des Vergessens“ anheimgefallen, nicht aber das Drumherum, die Bilder, die Schauspieler, die Erinnerung an den Dramatiker, der sein Stück sehr gebannt verfolgte und während der fünfundsiebzig Minuten nur zwei- oder dreimal seine Körperhaltung änderte, was mich dazu brachte, es ihm gleichzutun, weil ich Angst hatte, ich könne seine Konzentration stören. Der mehrmals erfolglos versuchte, den sich dicht vor ihm verbeugenden Schauspieler anerkennend am Unterschenkel zu tätscheln.
Eigentlich wollte ich mir vor Abfassung dieses Berichts den Text des Stückes aus der Bibliothek holen, aber das habe ich auch vergessen – nicht zuletzt, weil mir wohl etliche Bücher von und über Thomas Bernhard (!) wichtiger waren. Nicht vergessen habe ich den Besuch beim Urologen, der mich auslachte, als ich von meinen Befürchtungen berichtete. „Sie haben im Internet gestöbert, stimmt’s?“ Na, jedenfalls ist das Blut sehr schnell weniger geworden und inzwischen ganz verschwunden. Vorläufige Beruhigung.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
Die Verwandlung des Murat K.
I.
Ich will dir folgen, mein Prophet,
und tun, was du getan.
Dass ich schon bald verlasse,
der eitlen Zeiten Wahn.
Ich will dir ewig dienen,
dich preisen im Gebet,
des Himmels Lieder hören,
die leis’ die Nacht verweht.
Oh Allah, einz’ger Schöpfer
lass mich nicht länger warten
vergib mir meine SĂĽnden
führ’ mich in deinen Garten.
II.
Die schöne Zeit bei den Jama’at al-Tablighi ist um. Ich sitze im Bus zum Flughafen. In zwei Stunden geht es los. Endlich wieder nach Deutschland! Da, die typische Kontrolle. Verrückte Pakistanis!
„Die suchen Terroristen“, flüstert mir der Krawattenmann vom Nebensitz in gebrochenem Deutsch zu. „Amis zahlen fünftausend Dollar für Taliban und bis zwanzigtausend für Al Qaida-Mitglied, egal ob einer ist oder nicht.“
Ich schaue mich um und muss grinsen. Fast der ganze Bus ist voller möglicher Terroristen. Wenn diese Sicherheitsleute wollen, können sie eine Menge Kohle machen.
Dunkelhäutige Männer mit Turban, wild rollende schwarze Augen, verschleierte Frauen, verschlagene Gesichter, verwegen aussehende Gestalten wie aus einem Karl-May-Roman. Manche halten krampfhaft längliche, verschnürte Pakete auf dem Schoß ...
Mir kann ja nichts passieren, denke ich. Ich besitze zwar einen tĂĽrkischen Pass, habe aber unbefristetes Aufenthaltsrecht in Deutschland, blaue Augen, rote Haare, weiĂźe Haut ...
„Ihren Pass bitte!“ schnauzt mich der Uniformierte an.
Er blättert, schaut mich an, blättert zurück, schaut.
Er riecht nach SchweiĂź.
„Kommen Sie bitte mit.“
Mir wird mulmig. Was will der Typ von mir? Hat mein Aussehen ihn irritiert?
Das Gesicht auf meinem Passbild ist glatt, aber in den drei Monaten Pakistan habe ich mir einen Bart wachsen lassen. Weil ich tun möchte, was die Propheten taten. Alle Propheten trugen Bärte ...
Der Mann bringt mich aufs Polizeirevier. Dort werde ich verhört.
„Was haben Sie in Pakistan gemacht?“
„Ich habe den Koran studiert.“
„Wo haben Sie den Koran studiert?“
„In verschiedenen Koranschulen. Karachi, Islamabad, Lahore, Peshawar.“
Ich hoffe, dass die Aufzählung den Polizisten irgendwie positiv beeindruckt. Schließlich bin ich nicht nur Moslem, sondern auch ein Tourist, der Geld ins Land gebracht hat, der sich für das Land interessiert ...
„Haben Sie Kontakt mit Al-Quaida gehabt?“
„Nein.“
„Dann werden Sie sicher bald wieder freikommen.“
„Was heißt bald?“ Ich schaue auf die Uhr „Mein Flugzeug geht in eineinhalb Stunden.“
„Dieses Flugzeug werden Sie verpassen.“
„Aber meine Mutter erwartet mich, in Deutschland. In Bremen.“
„Nur die Ruhe. Sie werden Ihre Mutter sehen.“
Zu diesem Zeitpunkt weiß ich nicht, dass es viereinhalb Jahre dauern wird, bis ich wieder zu meiner Mutter darf. In dieser Zeit wird der Krieg in Afghanistan ausbrechen, ich werde nach Kandahar und von dort nach Guantanamo Bay gebracht werden. Ich werde stunden-, tage-, wochenlang verhört werden; an den Händen aufgehängt, in kaltes Wasser getaucht, nackt in der Kälte stehengelassen, mit Schlafentzug, Lärm, Lichtüberflutung und Isolationshaft gefoltert. Man wird mich schlagen, mit Elektroschocks quälen. Man wird mir vorwerfen, ich hätte Mohammed Atta und Osama Bin Laden getroffen. Ich sei mitschuldig an den Anschlägen des elften September.
Deutsche Männer, Männer der KSK, werden mich verhören, beschimpfen, meinen Kopf gegen den Boden schlagen und mich treten. Einer der Verhörer in Guantanamo wird mir grinsend verraten, dass die Amerikaner den Pakistanis nicht fünftausend, sondern dreitausend Dollar Kopfgeld für mich bezahlt haben.
Erst nach 1725 Tagen wird man mich, angekettet auf dem Boden einer Militärmaschine, an Händen und Füßen gefesselt, nach Deutschland, zu meiner Mutter bringen.
III.
Sie haben mir gesagt,
ich sollte zugeben,
dass ich von Al Qaida bin.
Dass sie mich dann auch in Ruhe lassen wĂĽrden.
Ich habe ihnen erzählt, dass ich,
dass ich nicht lĂĽgen werde.
Ich bin nicht von Al Qaida und
ich werde so was auch nicht sagen.
Sie haben immer wieder zugeschlagen.
Jedes Mal, wenn ich gesagt habe,
ich bin nicht von Al Qaida,
haben sie wieder zugeschlagen und von Neuem gefragt:
Bist du von Al Qaida?
Sie haben mir vielmals Papiere mitgebracht
und mich gezwungen,
dass ich unterschreiben sollte.
Und wenn nicht,
haben sie immer wieder zugeschlagen.
Und ich habe nie,
habe nie gesagt,
dass ich von Al Qaida bin,
habe auch nie
so was unterschrieben.
Sie haben gedroht,
einer von ihnen mit der Waffe.
Sie hielten eine Pump-Gun an meinen Kopf.
Er sagte, dass er mich erschieĂźen wĂĽrde.
Ich habe gelacht.
Alle anderen Gefangenen,
die haben auch gelacht.
Es war einfach ...
ich bin schon fast,
ich bin schon fast tot gewesen.
Falls er mich erschieĂźen wĂĽrde,
wär’s für mich einfach,
wär’s für mich
einfach viel einfacher,
es wär’ einfach ... fertig.
Ich mĂĽsste diesen ganzen Schmerz nicht mehr fĂĽhlen.
IV.
Interviewer: Herr Kauder, ich frage Sie jetzt nicht in Ihrer Rolle als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, sondern als Mensch. Wenn Sie das jetzt hören, dass da jemand fünf Jahre in die Mühlen der Nachrichtendienste und ihrer falschen Einschätzung gekommen ist – ihm sind fünf Jahre seines Lebens geklaut worden – was empfinden Sie da?
Vorsitzender: Sie werden es mir nicht übel nehmen, dass ich mich in meiner Rolle als Vorsitzender eines Untersuchungsausschusses auch in dieser Rolle bewegen werde. Ein Untersuchungsausschuss eines deutschen Parlamentes ist kein Tribunal gegen amerikanische Behörden. Es hat also keinen Sinn zu fragen, wie ich menschlich dazu stehe. Ich bin Jurist, ich würde gerne den Sachverhalt aufklären.
Interviewer: Wären Sie gerne jetzt einfach nur mal Mensch?
Vorsitzender: Meine menschliche Einstellung dient dem Herrn Kurnaz nicht. Im Gegenteil.
Interviewer: Fällt es Ihnen schwer, diese Rolle beizubehalten?
Vorsitzender: Das fällt mir überhaupt nicht schwer, da habe ich jahrzehntelange Übung als Jurist. Und es ist vielleicht gut, wenn jemand versucht, das objektiv abzuarbeiten und nicht für eine Seite Position ergreift und sich damit den Blick verstellt. Ich werde versuchen, das objektiv abzuarbeiten.
V.
Ich bin hier aufgewachsen.
Ich unterscheide mich nicht von anderen Deutschen.
Ich will wieder heiraten.
Ich will wieder Schiffe bauen.
Ich will eine Familie haben.
Murat Kurnaz
Arbeitsbeschreibung
Am 17. Oktober war der Deutschtürke Murat Kurnaz nach seiner Freilassung aus dem amerikanischen Häftlingslager in Guantanamo Bay zu einer Fernsehsendung bei Beckmann eingeladen.
Neunzehnjährig, war er nach Pakistan gereist, um den Koran zu studieren. Obwohl seine Mutter dies nicht unbedingt guthieß, hatte er sich in seiner Bremer Heimat zum strenggläubigen Moslem entwickelt. Das Gedicht unter I. könnte er in seiner persönlichen Sturm-und-Drang-Zeit geschrieben haben.
Seine Verhaftung hätte er als literarische Reportage à la Wallraff wie unter II. schildern können. Ich habe die Fakten mit dichterischer Phantasie ausgeschmückt.
(Nach meinem Empfinden handelt es sich bei dieser Arbeit zwar einerseits um den Versuch, das Hausarbeitsthema zu bewältigen, andererseits meine ich, dass etwas entstanden ist, das auch eigenständig bestehen könnte. Aus diesem Grund habe ich im letzten Absatz die weiteren Geschehnisse zusammengefasst.
Unter III. habe ich einen Teil des von Kurnaz in der Fernsehsendung gesprochenen Textes wörtlich transkribiert, ohne jede auch nur kleine Änderung und mit allen in freier Rede typischen sprachlichen Ungenauigkeiten. Meine Gestaltung besteht lediglich im Satz.
Ich habe mich hierzu anregen lassen durch das Gedicht von Erich Fried (Tiermarkt/Ankauf), das einen Anzeigentext lediglich setzerisch verändert.
IV. entstand aus einem wörtlich transkribierten Dialog aus der Fernsehsendung. Er fand statt zwischen Beckmann und dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses Siegfried Kauder. Ich habe ihn lediglich gekürzt und unwesentlich editiert. Er könnte in dieser Form aus einem Theaterstück der 60er Jahre stammen.
V. Dies sind Murat Kurnaz’ letzte Worte bei Beckmann. Sie wurden wörtlich in der Tageszeitung „taz“ vom 18.10.2006 abgedruckt.

Es handelt sich um das Hausarbeitsthema zu „Überblick über die deutsche Literaturgeschichte“ nach dem Seminar mit Prof. Jürgen Wolff im zweiten Semester meines Studiums “Kreatives Schreiben”. Wir sollten ein beliebiges heutiges Thema literarisch im Stil einer bestimmten Epoche der Literaturgeschichte behandeln. Mir machte das so viel Spaß, dass ich versuchte, gleich fünf verschiedene Stilrichtungen aus verschiedenen Zeiten nachzuahmen.
Wilfried von Manstein (2006)
|
 |
|
|
|
 |
 |
|
Carson McCullers: „Die Autobiographie“
1. Aufbau
Das Buch enthält nicht nur die unvollendete Autobiographie mit dem Titel Illumination and Night Glare, sondern auch einen ebenfalls unvollständigen Briefwechsel der McCullers mit ihrem Ehemann sowie eine mehrseitige Einleitung des Herausgebers. Im Anhang finden sich ein langes Exposé ihres Romans Das Herz ist ein einsamer Jäger und eine sehr ausführliche Chronologie, die vom 19. Februar 1917, Carsons Geburt in Columbus Georgia, bis zu ihrem Tod am 29. September 1967 in Nyack, New York reicht. Außerdem ein Werkverzeichnis und eine Liste mit Sekundärliteratur, darunter etliche Biographien anderer Autoren. Letzteres zeigt, wie groß das Interesse der Öffentlichkeit an der Autorin des Weltbestsellers Das Herz ist ein einsamer Jäger war und ist.
Carson McCullers konnte ihre Autobiographie nach mehreren Schlaganfällen nur unter allergrößten körperlichen Schwierigkeiten beginnen. Sie hatte Mühe zu sprechen, diktierte aber dessen ungeachtet Sekretärinnen, Freunden, Verwandten und Nachbarn – manchmal nur wenige Sätze an einem Tag. Sie fiel ins Koma und starb, ohne das Manuskript beenden oder auch nur begutachten zu können.
Stuart Sherman schreibt sinngemäß: „Wenn ich daran denke, wie sie Worte für die Niederschrift bildete, verschlägt es mir noch jetzt – so wie schon damals – die Sprache, so dass ich den Prozess, den ich beobachtete, nur auf faktischste Weise schildern kann.“
Über ihre Motivation sagt McCullers, dass sie zukünftigen Studenten des „Kreativen Schreibens“ (sie selbst absolvierte mindestens ein Semester eines entsprechenden Studiums) zeigen wollte, „warum ich manche Dinge tat“, aber auch, um ihnen zu helfen, mit Erfolgen umzugehen.
Denn ein großer Teil der Schwierigkeiten, denen sie in ihrem Leben begegnete, war der Tatsache zu verdanken, dass sie mit dreiundzwanzig Jahren durch ihren plötzlichen Ruhm „zu einer etablierten literarischen Persönlichkeit“ wurde, ohne dies wirklich zu verstehen, ohne die entsprechende Reife zu haben, in einer sehr schwierigen Beziehung lebend und körperlich durch diverse Krankheiten geschwächt.
Der Arbeitstitel ihrer Autobiographie spielt sowohl auf die nur selten eintretenden hellen Geistesblitze („illuminations“) an, denen sie ihre besten Bücher verdankt, als auch auf fiebrig durchwachte Nächte – „glare“ heißt wörtlich übersetzt „Glanz“, deutet aber auf schreiendes, aufdringliches Blenden hin, das im übertragenen Sinn auch Hass, Trotz und Wildheit ausdrückt, wenn es zum Beispiel im Zusammenhang mit Blicken gebraucht wird.
(Betrachtet man Fotos der jungen McCullers, so fällt ihr durchdringender Blick auf – gut zu sehen auch auf den unterschiedlichen Abbildungen, die die deutsche und die amerikanische Ausgabe der Autobiographie zieren.)
Die eigentliche kurze Autobiographie beginnt vielversprechend mit den Problemen, die Carson beim Schreiben von Das Herz ist ein einsamer Jäger hatte, verliert sich aber dann sehr schnell in Anekdoten und einer Aneinanderreihung von Namen bedeutender Persönlichkeiten, mit denen sie im Lauf der Zeit zusammentraf. Sehr schnell merkt man dem Text an, dass er posthum aus den mühsamen handschriftlichen Aufzeichnungen mehrerer Personen zusammengestellt wurde. Vieles ist nicht chronologisch, es schleichen sich (vom Herausgeber kommentierte) Irrtümer ein, die Sprache ist nachlässig – zumindest macht die ansonsten akzeptable Übersetzung in diesen Passagen einen entsprechenden Eindruck – der Text wirkt zunehmend bruchstückartig und endet dann unvermittelt.
Der Herausgeber, der Universitätsprofessor Carlos L. Dews schreibt, Illumination and Night Glare sei „eine komplexe Mischung aus Erinnerungen, später Selbstreflexion, Entmythologisierung und Remythologisierung. Es ist auch ein Versuch der Autorin, sich auf eine Weise, die ihrer eigenen Selbstwahrnehmung entspricht, in der Erinnerung zu verankern, auch wenn dies nicht immer exakt mit den biographischen Fakten übereinstimmt“.
Grundsätzlich dürfte gegen eine Autobiographie in dem von McCullers gewählten Stil nichts einzuwenden sein. Die angehängte Chronologie gibt einen ausreichenden Überblick über die Fakten und es ist Sache der Autorin, an welche Ereignisse, Gedanken, Personen sie sich erinnert und wie sie sie beschreibt. Jeder Autor – und sei sein Leben oder die gewählte Zeitspanne noch so kurz gewesen – könnte eine vielbändige Autobiographie schreiben, wenn er sich nicht auf bestimmte Aspekte beschränken würde. Auch das in künstlerischer Absicht vorgenommene Verändern und Verfremden von Ereignissen ist sicher legitim, man muss es allerdings in McCullers’ Fall als nicht gelungen bezeichnen. (Leben um zu schreiben von Garcia-Marquez dürfte in dieser Hinsicht beispielhaft sein.)
Das vierundreißigseitige Exposé von McCullers’ Roman Das Herz ist ein einsamer Jäger mit dem damaligen Arbeitstitel Der Stumme wurde auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin angehängt. Es stellt eine sehr wertvolle Quelle dar und ist als Teil der Autobiographie zu betrachten. Allerdings ist es in zwei anderen ihrer Werke ebenfalls enthalten. Auch der Kriegsbriefwechsel mit ihrem Ehemann Reeves gibt Aufschluss über das Denken und Leben der Autorin und es ist daher legitim, ihn in die Autobiographie einzubinden. In McCullers Fall blieb die an einer Stelle des Typoscripts enthaltene Anweisung „Hier Briefe einfügen“ aber zu vage. Carson sagte nicht, welche Briefe genau aufgenommen werden sollten, so dass der Herausgeber einfach das gesamte Konvolut in den Anhang stellte.
2. Lebensthema
Das Lebensthema der Schriftstellerin Carson McCullers war nach der übereinstimmenden Meinung vieler Kommentatoren die Liebe. Folgerichtig beginnt ihre Autobiographie mit dem Satz: „Mein Leben war, dem Himmel sei Dank, fast vollständig ausgefüllt mit Arbeit und Liebe.“ Eine Seite weiter zitiert sie erneut ausführlich ihr bereits erwähntes Exposé. Dessen zweiter Satz lautet: „Es handelt von der Revolte des Menschen gegen seine innere Isolation und von seinem Drang, sich so vollständig wie möglich auszudrücken.“
Diese Grundthemen ziehen sich nicht nur durch die Werke der McCullers, sondern auch durch ihre autobiographischen Aufzeichnungen.
Weitere Themen sind ihre Liebe zu ihrer Großmutter und zu ihrem Mann, den sie mit achtzehn Jahren heiratete, ihre Sexualität, ihre Angst vor Schreibblockaden und das Warten auf ihre „Erleuchtungen“. Sehr bald wird das Manuskript allerdings recht wirr, es gibt große Zeitsprünge und die nach dem Krieg immer schwieriger werdende Beziehung zu Reeves wird mehr und mehr thematisiert. (Es gab etliche Trennungen und Wiederversöhnungen – Carson ließ sich 1942 von ihm scheiden, heiratete ihn aber 1945 erneut.)
Ein weiteres wichtiges Thema bildet das Weiterarbeiten trotz schwerer Krankheit – Carson hatte ein eigenständiges Werk hierzu geplant (In Spite Of), merkte aber wohl, dass sie es nicht mehr verwirklichen kann und ließ die Thematik daher in ihre Autobiographie einfließen.
McCullers hatte viele prominente Freunde und schreibt gern über sie. Leider bleibt das meiste anekdotisch. Dennoch entsteht nach dem Muster ich höre dir eine Weile beim Plaudern zu und ich weiß wer du bist ein Bild ihrer Persönlichkeit.
3. Kritik
Publishers Weekly schreibt: „Dieser Memoiren-Mischmasch ist sicherlich das am wenigsten erfolgreiche Werk seiner Autorin. Dews, ein Englisch-Professor aus West-Florida gibt zu, dass es schwierig sei, dem diskursiven, der freien Assoziation folgenden Stil zu folgen, argumentiert jedoch, dass diese Kette von Assoziationen ein ausreichendes Organisationsprinzip darstellt. [...] Das Buch bleibt jedoch ein verwirrendes Pseudokunstwerk und die Autorin erscheint darin selbstverliebt und langweilig. McCullers' Erwähnung anderer Schriftsteller ist nicht mehr als das und erschöpft sich in huldvollem Geplauder. So gäbe es sicherlich über Isak Dinesen (Karen Blixen) mehr zu sagen, als dass sie eine späte Vorliebe für Austern und Champagner hatte.“
Mein Motiv, mir die Autobiographie zu kaufen, resultierte aus der Beschäftigung mit dem wundervollen Roman Das Herz ist ein einsamer Jäger und der Hoffnung, dass McCullers die darin zu ahnenden autobiographischen Bezüge erläutert. Dies ist leider nicht der Fall – im Gegenteil, die Autorin behauptet, es gäbe solche Bezüge nicht.
Andererseits: Eine der Hauptpersonen in Das Herz ist ein einsamer Jäger, die kleine Mick, wünscht sich sehnlichst ein Klavier und kann sich klassische Musikstücke vollständig merken. McCullers selbst fing sehr früh mit dem Klavierspielen an und galt als musikalisches Wunderkind. Es ist jedenfalls zu vermuten, dass die Autorin sich am ehesten mit der kleinen Mick identifizierte.
Dennoch: Wäre da nicht das ausführliche Exposé von Der Stumme, müsste man – zumindest als angehender Autor – bereuen, das Buch gekauft zu haben. (Stephen King hat mit Das Leben und das Schreiben gezeigt, wie man Biographisches und Tipps für Autoren miteinander verbinden kann.)
Der Briefwechsel Carson-Reeves gehört zum Langweiligsten, was ich je gelesen habe. Man kann aus ihm lediglich entnehmen, dass die beiden sich zu dieser Zeit sehr geliebt haben – was allerdings während einer langdauernden Trennung und in einem furchtbaren Krieg ganz natürlich ist und im Grunde nichts bedeutet. Nicht ein einziger Satz in diesen Briefen, auch nicht in den Liebeserklärungen, hat eine wie immer geartete literarische Qualität. Carsons hier enthaltene Andeutungen über ihre Arbeit sind spärlich und beschränken sich auf Aussagen wie: „Ich sitze stundenlang vor der Schreibmaschine und tue so, als würde ich arbeiten.“ Einzig mit ihren seltenen Hinweisen auf Bücher, die sie in dieser Zeit liest, kann ich für mich etwas anfangen. (So werden z.B. Henry James und Virginia Woolf erwähnt.)
Der Informationsgehalt der meisten Briefe entspricht in etwa jenem in: „Gestern habe ich einen Brief an Elizabeth geschrieben und werde wahrscheinlich bald von ihr hören.“ (Carson an Reeves) oder „Ach liebste Carson, deine Briefe haben so gut getan, so gut. Ich habe sie, beim ersten angefangen, alle gelesen.“ (Reeves an Carson). Bezeichnend, wie oft der Alkohol eine Rolle spielt: „Ich habe mich allein in ein Zimmer zurückgezogen, um sie zu lesen, und dabei meine Taschenflasche Scotch hervorgeholt ...“ (Reeves an Carson).
Schade, dass weder der Alkoholismus, noch die bisexuelle Veranlagung der Eheleute in den Briefen thematisiert wird. Auch die Autobiographie enthält keinen Hinweis darauf.
Bedauerlich, dass der amerikanische Herausgeber sowie sein Verlag sich nicht zu schade waren, eine derartige Sammlung von Nichtssagendem zu veröffentlichen. Carson bat zwar um ihre Einfügung, aber ich bin sicher, wenn sie ihr vorgelesen worden wären, hätte sie darauf verzichtet.
Nun gut, auch eine große Schriftstellerin ist nicht immer selbstkritisch – oder vielleicht erst, wenn die Kritiken schlecht waren? So schreibt Carson nach dem Desaster mit Squareroot of Wonderful: „Es ist schwer zu sagen, wieso ich diesen Mist überhaupt schrieb; aber natürlich hatte ich keine Ahnung, dass das Stück so schlecht war.“
4. Resumee
Selbstverständlich laste ich die Mängel ihrer Autobiographie nicht der Autorin an, sie wurde posthum veröffentlicht, blieb unvollendet und entstand unter allerÂschwieÂrigsten Bedingungen. Einigen Aussagen der Menschen zufolge, die Carsons Diktate aufnahmen, tat sie sich schwer mit dem Verfertigen und Sprechen jedes Satzes – sie, die gewöhnt war, selbst an der Schreibmaschine zu sitzen und bis zu zwanzig Mal zu ĂĽberarbeiten, lag nun hilflos, halb gelähmt im Bett und konnte das Geschriebene nur hören, nicht aber sehen.
Die Mängel sind offensichtlich, das Motiv für die Veröffentlichung scheint mir hauptsächlich kommerzieller Natur zu sein, dennoch habe ich die Beschäftigung mit der Autorin Carson McCullers nicht bereut. Der Kontrast der späten Worte zum frühen Werk zeigt einmal mehr, wie viel Mühe und Schweiß in beidem steckt. Das Buch ist trotz seiner Mängel nicht ohne Unterhaltungswert, bietet Anregungen für eigene Geschichten und enthält nicht zuletzt einige wunderbare Fotos, so zum Beispiel eines von Edith Sitwell „der führenden Exzentrikerin“, die McCullers auf ihrer Englandreise besuchte. Deren Autobiographie werde ich mir vielleicht als nächstes vornehmen.
Wilfried von Manstein (2007)
Anmerkung: Dies ist die Hausarbeit zum Seminar “Autobiografie”, geleitet von Hedwig Dejako.
|
|
