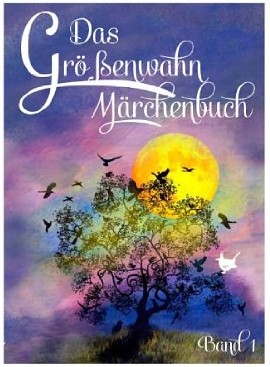|
|
|
|
 |
 |
|
Die Anthologie ist im adw-Verlag erschienen:
ISBN 978-3-939211-60-0
zu bestellen in jeder Buchhandlung.
|
|
 |
 |
|
Worte - nichts als Worte ...
Es war einmal ein Buch, das stand in einer Bibliothek. Ewigkeiten waren vergangen, seit jemand es aufgeschlagen oder gar ausgeliehen hatte und die Seiten waren arg vergilbt. Die Bindung begann sich aufzulösen und es roch auch nicht besonders gut, denn der Raum wurde selten gelĂŒftet.
Die Wörter in diesem Buch waren verblasst und hatten lange nicht mehr miteinander gesprochen - es herrschte meist Totenstille zwischen den Seiten. Viele Wörter sahen keinen Sinn mehr darin, sich zu Ă€uĂern. Sie waren zu hohlen Worten oder gar toten Wörtern geworden.
Aber ein Wort gab es, das sich nicht mit diesem Zustand abfinden wollte und das hieĂ Wahrheit. Die Wahrheit spitzte die Ohren und lauschte in das Buch hinein, in der Hoffnung auf das eine oder andere Lebenszeichen. Da war ein gelegentliches Klicken eines Konsonanten oder das Brummen eines Vokals zu hören, sogar einige Wortfetzen flatterten vorĂŒber.
Die Wahrheit schöpfte Hoffnung und machte sich auf den Weg durch die Seiten des Buches.
Als sie das Sprichwort fand, stieĂ sie es mit dem FuĂ an und rief: âHe, lebst du noch?â
Das Sprichwort klappte eines seiner uralten, mĂŒden Augen auf und murmelte: âReden ist Silber, Schweigen ist Gold.â Dann stellte es sich mundtot.
âSo leicht kommst du mir nicht davon!â, sagte die Wahrheit und schlug ihm das Ausrufungszeichen ĂŒber den Kopf.
âWort ohne Tat ist ein Acker ohne Saatâ, presste das Sprichwort hervor und murmelte dann aufgebracht: âBesser eine LĂŒge, die heilt, als eine Wahrheit, die verwundetâ.
Die Wahrheit aber hatte verstanden: Sie musste etwas tun, um ihre Sehnsucht zu stillen und vielleicht sogar am Ende einen Wortschatz zu finden.
Sie las das ganze Buch, legte jedes Wort auf die Goldwaage und entdeckte auf diese Weise die Freiheit. Die wirkte noch recht frisch und lebendig. Das Sprichwort, das die Sache am Rande mitverfolgt hatte, nuschelte vor sich hin: âFreiheit, wie gering, ist doch ein teuer Ding.â
âHe Freiheitâ, rief die Wahrheit.
âVom Wahrsagen lĂ€sst sichâs wohl leben in der Welt, nicht aber von der Wahrheitâ, zitierte die Freiheit.
âFĂŒhlst du dich wohl an diesem Ort?â, fragte die Wahrheit.
âSchon lange nicht mehr, denn dieses Buch ist furchtbar langweilig,â sagte die Freiheit. âIch habe freie Bahn, aber wohin? Ich habe freie Hand, aber wofĂŒr? Ich habe freie Wahl, aber es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, dass ich wie gelĂ€hmt bin. Um meine Gesundheit zu erhalten und den Kopf frei zu kriegen, laufe ich jeden Tag ein bisschen zwischen den Seiten, wovon ich allerdings meist Seitenstechen kriege.â
âAls Wahrheit könnte ich dir sagen, was man gegen die Langeweile tun kannâ, sagte die Wahrheit.
âWas denn?â, fragte die Freiheit neugierig.
âWir gehen auf Wanderschaft.â
âHinaus in die Freiheit? Keine schlechte Idee.â Und nach kurzem Nachdenken fĂŒgte sie hinzu: âWarum hast du es nicht lĂ€ngst versucht?â
Die Wahrheit antwortete: âDenk doch mal nach. Um hier herauszukommen, muss man frei sein! Tun wir uns also zusammen und gehen auf die Reise!â
Gesagt getan. Die beiden Wörter griffen sich einen Bindestrich und verlieĂen das alte, nutzlose, muffige Buch.
Ein paar Stockwerke höher fanden sie ein Lehrbuch der Philosophie. Es war viel dicker als ihr altes Zuhause und auch viel besser gebunden und es wurde noch fleiĂig von den Benutzern der Bibliothek ausgeliehen.
âHier finden wir vielleicht eine neue Heimatâ, sagte die Freiheit und sie klopften an.
Da ertönten viele wortgewaltige Stimmen aus dem Plastikeinband, die riefen: âNein, nein. Dieses Buch ist schon besetzt! Es ist gespickt mit Wahrheiten. Selbst die FuĂnoten sind prall gefĂŒllt damit. Wahrheiten, die sich widersprechen. Wahrheiten, die sich bekĂ€mpfen. Wir sind ĂŒberfĂŒllt und die dauernden Wortgefechte sind kaum auszuhalten. Selbst nachts herrscht stĂ€ndiges Wortgeklingel.â
Und so gingen sie weiter.
Und kamen zu einem anderen Buch, das enthielt nicht nur Wahrheit, es hieĂ Die Wahrheit. Aber bevor sie anklopfen konnten, schrie eine Stimme aus dem Buch: âFort! Hinweg! Kommt mir nicht zu nahe! Ich bin die einzige Wahrheit, die gröĂte Wahrheit, die letztendliche Wahrheit, â keine Wahrheit kann neben mir bestehen!â
âAber ich bin doch auch die Wahrheit. Wie kann ich etwas anderes sein als du?â
âEs kann nur eine einzige Wahrheit gebenâ, sagte das Buch und schlug sich selbst mit lautem Knall den beiden Wörtern vor der Nase zu. Dabei entwich ihm eine so ekelhafte Staubwolke, dass Freiheit und Wahrheit husten mussten.
Sie klopften sich gegenseitig den Staub von den Buchstaben und die Wahrheit sagte: âDie Wahrheit scheint ein kompliziertes Ding zu sein, vielleicht sollten wir es mal mit der Freiheit versuchen?â
Gesagt getan.
BĂŒcher ĂŒber Freiheit waren recht selten, aber schlieĂlich fanden sie eines. Es sagte: âDie Freiheit darf ruhig hereinkommen, aber die Wahrheit muss drauĂenbleiben.â
âWarum denn das?â, fragte die Freiheit. âDie Wahrheit ist mein Freund, wir sind zusammen auf Wanderschaft und wollen uns auf keinen Fall trennen.â
âEs gibt keine endgĂŒltige Wahrheitâ, antwortete das Buch ĂŒber die Freiheit. âJeder ist frei, seine eigene Wahrheit zu finden. Daher sind wohlfeile Wahrheiten hier nicht erwĂŒnscht. Ihr mĂŒsst weiterziehen.â
âWeiĂt du nicht einen Ort, an dem wir willkommen wĂ€ren?â, fragte die Freiheit.
âVersucht es mal bei der Weisheit. Die weiĂ vielleicht guten Rat.â
Aber BĂŒcher der Weisheit waren noch seltener als BĂŒcher der Freiheit. So groĂ die Bibliothek auch war, Weisheit war keine darin zu finden. Unsere Wörter mussten das riesige GebĂ€ude verlassen und vagabundierten durch die Stadt und gelangten schlieĂlich zu einem Stapel von Papieren, an denen ein Schriftsteller arbeitete, der seine Arbeit sehr ernst nahm und alle Weisheitslehren der Welt studiert hatte.
Anklopfen konnte man dort nicht, denn es handelte sich um lose, vom Luftzug bewegte BlÀtter, denen man ansah, dass sie stÀndig ausgetauscht und korrigiert wurden.
Die Weisheit auf diesen Manuskriptseiten hatte die beiden schon von weitem bemerkt und ehe Freiheit und Wahrheit den Mund aufmachen konnten, verkĂŒndete sie: âWas ich da schwarz auf weiĂ vor mir sehe, sind nur Wörter. Freiheit, paah, Wahrheit, puuh. Wörter können nicht sein, was sie bezeichnen. Ihr seid nur Symbole; eigentlich nur schwarze PĂŒnktchen. Fliegendreck.
Mein weiser Autor möchte ein Buch ĂŒber die wahre, wirkliche Wahrheit und die wirkliche, wahre Freiheit schreiben. Ihr WorthĂŒlsen taugt doch nur zum Plappern und Salbadern, Schwadronieren und SchwĂ€tzen.
Geht hinaus in die Welt, und stellt euch der Wirklichkeit und wenn ihr das geworden seid, was ihr bezeichnet, könnt ihr meinetwegen zurĂŒckkommen.â
Mit diesen Worten verschwand die Weisheit im Wust der Papiere.
âHe Moment!â, rief die Wahrheit. âWenn wir nur Wörter sind, dann trifft das doch auf dich auch zu, oder?â
âDas ist ja das Problemâ, sagte die Weisheit und streckte ihr âWâ aus dem Stapel. âMir geht es wie euch. Allerdings kenne ich den Namen der Krankheit, Ihr aber nicht.â
âSo?â, fragte die Freiheit. âWie heiĂt denn die Krankheit?â
âWortklauberei!â rief die Weisheit und verschwand in ihrem BlĂ€tterstapel. Keine Silbe war mehr von ihr zu hören. Das machte die beiden Wörter sehr traurig. Sie suchten sich ein PlĂ€tzchen in einem der WörterbĂŒcher auf dem Regal, um sich auszuruhen und zu beratschlagen, was als nĂ€chstes zu tun sei.
Am nÀchsten Morgen setzte sich der Schriftsteller an seine Schreibmaschine, spannte ein leeres Blatt ein und bohrte in der Nase.
Dann blÀtterte er ratlos durch den Stapel seiner Manuskriptseiten.
Die Wahrheit und die Freiheit wachten auf. Hurtig hĂŒpften sie aus dem Wörterbuch und tanzten vor seinen Augen und schwirrten ihm im Kopf herum, um auf sich aufmerksam zu machen.
Der Autor rieb sich die plötzlich juckende Nase und zog an seinen OhrlÀppchen.
SchlieĂlich schrieb er viele kluge Worte ĂŒber den Willen zur Wahrheit und den Drang zur Freiheit, aber dann schĂŒttelte er den Kopf, raufte sich die Haare, riss das Papier aus der Maschine und warf es in den Kamin.
âWir werden verbrannt werden, wenn wir hier im Kamin bleibenâ, sagte die Wahrheit.
âMir wĂ€re es rechtâ, sagte die Freiheit. âDann hat die Suche ein Ende und wir sind wirklich frei.â
Und die Wahrheit murmelte nachdenklich: âVielleicht hast du recht. Die Wahrheit mag in dem liegen, was nicht gesagt werden kann.â
Die beiden Wörter warteten also im Kamin, bis der Schriftsteller sich am Abend mit einem Glas Wein davor setzte und das Feuer hell aufloderte.
Und wĂ€hrend sie ohne einen Mucks verbrannten, lösten sie sich auf und kehrten zu ihrem Ursprung zurĂŒck, zum Nichts, zur Leere. Aber das waren keine leeren Worte, sondern das war unendliche FĂŒlle. An diesem Ort waren sie eine Einheit geworden, nicht nur miteinander, sondern mit allen Wörtern, die es gab und die es noch geben wĂŒrde.
Und der Schriftsteller schaute in die Flammen und merkte es auch. Nur wie er das aufschreiben sollte, wusste er immer noch nicht.

Abschied
Lieber Frank,
erinnerst du dich an die Zeit, als wir auf DrĂŒcker-Tour gingen und einen Haufen Geld verdienten? Damals hast du mir das Pokern beigebracht und nach wenigen Tagen war ich sĂŒchtig. Nie werde ich die erste Nacht vergessen, in der wir bis zum Morgengrauen spielten: Wir rauchten furchtbar viel, tranken jede Menge Bier und Apfelwein, ohne betrunken zu werden und mĂŒde wurden wir auch nicht. Nicht der Hauch von MĂŒdigkeit â im Gegenteil, wir fĂŒhlten uns wacher und wacher. Das Zocken wirkte auf mich wie ein Aufputschmittel, ich war Hauptdarsteller in einem tollen Film, meine Sinne schĂ€rften sich, ich nahm ĂŒberdeutlich alles wahr, was uns und unser Spiel betraf, und blendete aus, was nicht zu diesem Spiel gehörte: andere Menschen, die Zukunft, die Probleme der Welt.
Noch heute, nach fast fĂŒnfzig Jahren, sehe ich vor meinem inneren Auge dein Grinsen, das mich damals schon an Jack Nicholson erinnerte, unseren Tisch, das Licht, die grĂŒne Tischdecke, die SchirmmĂŒtzen, die Sonnenbrillen, die Haufen von Geldscheinen, genau wie man das aus dem Kino kennt ... Sag mal, hat sich die Wirtin unserer Stammkneipe eigentlich strafbar gemacht, wenn wir uns im Hinterzimmer die Nacht um die Ohren hauten?
Na ja, was ich sagen will â ich habe damals kapiert, was es bedeutet, hundertprozentig im Hier und Jetzt zu sein, alles dumme Zeug auszublenden und sich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Man könnte das ja theoretisch immer haben, denke ich, aber nur beim Spielen geht es ja um etwas wirklich Wichtiges, etwas, das ĂŒber dein Leben, deine Stellung in der Gesellschaft entscheidet, um das Wichtigste im Leben ĂŒberhaupt â vielleicht auĂer der Liebe â um Geld. Viel Geld.
Ich entdeckte an jenen Abenden meine Liebe zum Geld.
Einmal, als ich gewonnen hatte, warf ich zu Hause den dicken Stapel Scheine in die Luft und ich werde nie das Gesicht meiner damaligen Freundin vergessen, die schon zu einer Schimpftirade ansetzte, nachdem sie die ganze Nacht auf mich gewartet hatte, als die Scheinchen auf sie herunterregneten und das Bett und den Teppich bedeckten. Ein FĂŒnfziger hat ĂŒbrigens danach gefehlt und ist nie wieder aufgetaucht, noch Jahre spĂ€ter â immer wenn wir blank waren â haben wir danach gesucht. Da muss der Teufel seine Prozente abkassiert haben. Jedenfalls, bevor wir das Geld wieder einsammelten, hatten wir Sex zwischen den knisternden Hundertern, und Belinda hat noch ziemlich lange bei ihren Freundinnen damit angegeben, was ich doch fĂŒr ein toller Typ sei. Eben ein Typ wie aus der Art Film, die wir damals liebten. Easy Rider und so.
Belinda ist ĂŒbrigens vor zwanzig Jahren abgekratzt, aber das weiĂt du ja, denke ich. Ich sagâs nur, falls dein GedĂ€chtnis ebenso schlecht geworden ist, wie meines.
Tja, die letzten zwanzig oder dreiĂig Jahre sind fĂŒr mich wie in einem undurchdringlichen Nebel entschwunden, wohingegen mir unsere Pokerzeit leuchtend, wie mit dem Skalpell ausgestanzt vor Augen steht. Sogar an die GerĂŒche kann ich mich erinnern: deine Gitanes, meine Roth-HĂ€ndle, Woodys Zigarillos ... Komisch, heute reagiere ich allergisch auf Zigarettenrauch, aber damals roch das wirklich nach Freiheit und Abenteuer. Heute könntest du mich jagen mit Kneipendunst und Zigarrenqualm, aber zu jener Zeit war es das Paradies. Wie konnte das sein?
Unsere Wirtin Susanne hat mich irgendwann einmal drauf aufmerksam gemacht, dass ich an bestimmten Tagen schon nach einer Stunde ĂŒber den Rauch meckere, dass ich aber an manchen Abenden von sieben bis halb zwei ĂŒberhaupt nichts davon merke. âUnd was sind das fĂŒr Abende?â, fragte ich sie und sie antwortete: âWenn eine nette Frau neben dir an der Bar sitzt und du dich langsam verliebst und hoffst, sie abzuschleppen.â
NatĂŒrlich hatte sie recht. Denn das war ja exakt das Geheimnis des Spielens gewesen â die Zeit verging genau so intensiv, als ob man sich gerade verlieben wĂŒrde. Selbst das PissenmĂŒssen konnte man vergessen und nicht nur einmal hatte ich es im letzten Moment gerade noch aufs Klo geschafft. Ganz zu schweigen von Schmerzen, EnttĂ€uschungen, Probleme mit den Eltern und so weiter â nichts davon war wichtig oder wurde auch nur bemerkt, so lange wir spielten.
Das Gewinnen war offensichtlich nicht das Wichtigste, ja, ich muss gestehen, dass der allergeilste Morgen, an den ich mich erinnere, jener war, an dem ich ohne eine mĂŒde Mark nach Hause ging. Wir hatten vier Wochen geackert wie die VerrĂŒckten, hatten im ganzen Land Zeitschriften-Abos verkauft und kamen mit viertausend Mark â was in den Sechzigern eine Menge Geld war â nach Hause, und in der selben Nacht habe ich alles verzockt bis auf den letzten Pfennig. Und was dann geschah, erschien mir wie ein Wunder: Ich lachte wie der lachende Buddha auf der Kommode meiner Patentante Lotti â ein Rauchverzehrer aus Porzellan â und ich fĂŒhlte mich unglaublich frei und leicht und tanzte auf dem Heimweg. Und ich werde nie vergessen, wie die doofe Nachbarin guckte, als ich hĂŒpfend im leuchtenden Sonnenlicht im Hausflur auftauchte und ihr sagte, wie blendend sie aussĂ€he.
An diesem Morgen habe ich verstanden, wie glĂŒcklich es macht, wenn man nichts mehr hat, wenn alles weg ist. Das ist Freiheit. Ich danke dir von ganzem Herzen fĂŒr diese Erfahrung.
Dein Moritz
PS
Ach so, jetzt habe ich fast das Wichtigste vergessen: Wegen meiner vielen Schulden bei dir möchte ich dir mein Auto vermachen. Die Abgase wird man hoffentlich nicht mehr riechen, und dass ich darin die absolute Freiheit gefunden habe, stört dich sicher auch nicht. Ăbrigens ist dieser Brief auch ein Beweis dafĂŒr, dass kein Fremdverschulden vorliegt, falls das bei Polizei oder Justiz ein Thema werden sollte, was ich aber nicht glaube.
|
|
|
 |
 |
|
Dieser Text wurde zusammen mit 21 weiteren aus 449 Einsendungen ausgewÀhlt und erschien in der Anthologie des Arbeitskreises gegen Spielsucht
Bunte Lichter - dunkle Schatten - GlĂŒcksspiel - Faszination und Abgrund
ISBN 978-3-86685-389-8
Zu bestellen bei amazon.
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
Des alten Schreiners Reise in die neue Zeit
Der alte Schreiner hockte in seinem Wald und sagte sich: »Wenn ich mal sterbe, werden meine mĂ€rchenhaften Sachen fĂŒr immer vergessen sein.«
Also nahm er den Esel und band ihm das Tischchen auf den RĂŒcken, warf sich den Sack ĂŒber die Schulter und begab sich auf die Wanderung in die groĂe Stadt.
Als er sich einem der Vororte nĂ€herte, sah er junge Leute, die neben der StraĂe saĂen und rauchten, Bier tranken, und sicher gerne etwas AnstĂ€ndiges lernen wĂŒrden.
Er fragte: »Will jemand von euch Tischler werden?« Da lachten sie ihn aus.
»Damit wir in drei Jahren Hartz vier kriegen«, sagte einer und ein anderer rief: »Null Bock, Alter, mach dich vom Acker.«
»Iahhhh!«, schrie der Esel.
»Habâs nur gut gemeint«, brummte der Schreiner und zog weiter.
Nach kurzer Zeit ĂŒberholte ihn ein Polizeiwagen und bremste. Ein Polizist und eine Polizistin stiegen aus, musterten den Alten in seinem gestreiften Kaftan und fragten nach seinen Papieren.
»Papiere? Ich bin Schreiner, und was ich auĂer meinem Esel mitfĂŒhre, ist aus altem Holz geschnitzt«.
»Wie heiĂen Sie?«
Der alte Tischler wusste es nicht, aber dann fiel sein Blick auf ein Schild gegenĂŒber und so sagte er: »Baran-ka-uf«.
»Keine Papiere, Herr Uff? Dann mĂŒssen wir Sie mitnehmen aufs Revier.«
»Hör mal, Kevin«, sagte die Polizistin zu ihrem Kollegen, »was willst du denn mit dem Esel anfangen? Wir haben bald Feierabend!« Kevin wandte sich an den Alten: »Okay, du gehst jetzt diesen Weg dort rein und suchst dir einen Platz, wo du deinen Esel unterstellst und morgen gehst du zur AuslÀnderbehörde und aufs Ordnungsamt. Hast du Geld?«
Der Alte lachte: »Wenn es sonst nichts ist.« Er holte ein Tischtuch aus seinem GepĂ€ck und hieĂ den Esel, sich darauf zu stellen. Da lachten die Beamten: »Schon gut â das ist sicher ein Goldesel.« Kichernd stiegen sie in ihren Polizeiwagen und brausten davon.
»Bricklebrit«, rief der Alte und der Esel spie vorne und hinten je zwei GoldstĂŒcke. Die wollte der Schreiner bei einer Bank eintauschen, aber ohne Konto war das nicht möglich. »Gehen Sie zu einem GoldhĂ€ndler,« bedeutete man ihm.
Ein solcher befand sich in der NĂ€he. Er wog die altertĂŒmlichen Dukaten, rieb sie auf einem PrĂŒfstein, tupfte eine SĂ€ure darauf und legte sie auf die elektronische Waage. Dann rĂŒckte er ein dĂŒnnes BĂŒndel Scheine heraus. Der Alte ahnte, dass er betrogen wurde, doch das störte ihn nicht, schlieĂlich war Nachschub fĂŒr ihn kein Problem.
Und er wusste sich anzupassen. Er kaufte sich einen schicken Anzug, lieĂ sich rasieren, frisieren und mietete sich in einen Reitergasthof ein. Dort schreinerte er sich einen Reisepass, und auch sein Esel erhielt eine Plakette. Den KnĂŒppel-aus-dem-Sack verstaute er in einem nagelneuen Aktenkoffer.
Dann erkundete er Stadt und Menschen.
Er fand heraus, dass ihr Hauptinteresse darin bestand, viel zu essen und zu trinken und das möglichst ohne langes Warten und zu jeder Zeit.
Da kann ich helfen, dachte er.
Er vergröĂerte und modernisierte sein geschnitztes Tischchen und stellte es auf den Marktplatz. Dazu ein Schild mit der Aufschrift: »Essen und Trinken frei«.
Kaum waren die Ersten gesĂ€ttigt, strömten die Menschen herbei und worauf auch immer sie Appetit hatten, das erschien auf dem Tisch. Pizza und Hamburger, Bratwurst und Pommes, halbe HĂ€hnchen und Schweinshaxen, warme Semmeln und Brezeln, Döner, Spaghetti, Kaffee, Tee, Bier, Cola, Limonaden und SĂ€fte aller Art sowie Mischungen von alledem wurden gewĂŒnscht, gegessen, getrunken und brauchten nicht bezahlt werden. Binnen kurzem war der Marktplatz schwarz von Frauen und MĂ€nnern, Kindern und Hunden.
Der Alte wunderte sich, dass kaum jemand ein schmackhafteres Gericht oder ein edleres GetrĂ€nk wĂŒnschte und dass viele gleich mehrere Portionen bestellten und in mitgebrachten TĂŒten verstauten. Bald waren die ZugangsstraĂen zum Marktplatz verstopft und die Polizei versuchte vergeblich, den Verkehr zu lenken. Gesundheitsamt und Bezirksinspektion schickten Beamte los, die es aber ebenso wenig zum Tischlein des Meisters schafften wie die Wirte im Umkreis, deren Gasthöfe sich geleert hatten und die herauskriegen wollten, wer ihnen da Konkurrenz machte.
Problematisch war, dass das Tischlein zwar Unmengen an Speisen und GetrĂ€nken produzierte, dass es aber Geschirr und Essensreste nicht zurĂŒcknahm, so dass sich Berge von Abfall bildeten. Als die Herbeieilenden mit denen zusammenstieĂen, die den Platz verlassen wollten, und hierdurch die Gefahr bestand, dass man sich gegenseitig tottrat, musste der Alte einsehen, dass sein Tischlein weder in diese Stadt, noch in diese Zeit passte.
Er klappte es zusammen und verkĂŒndete das Ende der Speisung.
Es wurde spÀte Nacht, bis die Menge sich verlaufen hatte.
Nun kam der unvermeidliche und abermalige ZusammenstoĂ mit der Polizei und den Behörden, doch Meister Baranka hatte ja nun einen Pass und konnte zusagen, fĂŒr alle Kosten aufzukommen. Die Leute vom Gesundheitsamt verboten ihm, jemals wieder Ausschank und Restauration in der Stadt zu betreiben und stellten ein Verfahren wegen VerstoĂ gegen lebensmittelhygienische Auflagen und fehlender Gestattung nach § 12 des GaststĂ€ttengesetzes in Aussicht. Vor den erbosten Restaurantbesitzern und Kneipiers der Umgebung konnte der Meister sich nur mit Hilfe des KnĂŒppels aus dem Aktenkoffer retten.
»Ich habâs nur gut gemeint«, sagte er.
Dennoch wollte er noch einen dritten und letzten Versuch wagen. Er kaufte einen Pferdetransporter mit Wohnkabine und richtete ihn fĂŒr sich und sein Eselchen gemĂŒtlich ein.
Er mietete ein GelĂ€nde, auf dem die Leute sich ohne DrĂ€ngelei anstellen konnten und HilfskrĂ€fte, die fĂŒr einen geordneten Ablauf zu sorgen hatten.
»Bricklebrit«, â der Esel begann mit der Dukatenproduktion.
Auch dies sprach sich so schnell herum, dass bald sĂ€mtliche ZufahrtsstraĂen blockiert waren. Jeder wollte der Erste sein, jeder wollte möglichst viel Gold, am besten alles. Der Meister musste auf zwei GoldstĂŒcke pro Person begrenzen, gleich zwei Feinunzen, also etwa 60 Gramm. Der Esel produzierte 240 Dukaten pro Minute, gleich 7,2 Kilogramm, 432 Kilo pro Stunde, also mehr als zehn Tonnen pro Tag und in einem Jahr wĂŒrden es 3784 Tonnen sein. Selbst wenn man dem Esel Erholungspausen gönnte, war das fast die doppelte Goldproduktion der ganzen Welt.
Die Auswirkungen waren bereits nach wenigen Tagen zu spĂŒren. Vor Banken und GoldhĂ€ndlern bildeten sich lange Schlangen, internationale Fernsehteams landeten auf dem Flughafen, der bald hoffnungslos verstopft war, weil aus der ganzen Welt die Goldsucher herbeiströmten. Fern- und Nahverkehr brachen zusammen, die Stadt lag im Koma. Die Behörden mussten einschreiten. Es war zwar nicht verboten, Gold zu verschenken, aber die öffentliche Ordnung durfte man nicht stören.
Der BĂŒrgermeister und einige Mitglieder des Stadtrats flogen mit einem Hubschrauber zu dem GelĂ€nde und wurden mangels Landeplatz auf das Dach des Wohnmobils abgeseilt. Sie flehten den Schreiner an, auf Versand umzustellen oder Gold-Automaten aufzustellen. Meister Uff lehnte ab. Entweder ĂŒbergab er seine GoldstĂŒcke persönlich oder er wĂŒrde wieder in seinen Wald zurĂŒckkehren. Die Abordnung trat den RĂŒckzug an, nicht ohne um ein paar Dukaten fĂŒr die Stadtkasse zu bitten. Das wurde erfĂŒllt; fĂŒr Verwandte und Freunde wanderte ein Teil in die eigenen Taschen.
Der Goldpreis sank.
Eine Expertenkommission rechnete aus, dass der Wert der weltweiten Goldreserven sich in wenigen Jahren so vermindern wĂŒrde, dass den Staaten Verluste in Milliardenhöhe entstĂŒnden, ja, dass Gold in absehbarer Zeit weniger wert sein wĂŒrde als Eisenschrott.
Niemand ging noch zur Arbeit, alle quetschten sich durch die StraĂen, in der Hoffnung, zur Uffschen Goldfabrik durchzudringen. Es kam zu GewaltausbrĂŒchen, weil manche sich um die besten PlĂ€tze prĂŒgelten. Nachdem die Ersten zusammengebrochen waren und nirgendwo eingeliefert werden konnten, wurde klar, dass man Baranka Uff seine TĂ€tigkeit verbieten musste.
Das »UffâGesetz«, wie man es nannte, wurde verabschiedet und die Goldfabrik geschlossen. Es dauerte aber noch lange, bis sich die Menschen verlaufen hatten, ihre Arbeit wieder aufnahmen und der Goldpreis sich erholte.
»Ich habâs nur gut gemeint«, sagte der alte Schreiner.
Einen letzten Scherz erlaubte er sich jedoch. Und zwar stellte er den Aktenkoffer mit dem KnĂŒppel auf den Marktplatz und stieg in sein Wohnmobil. Nach dem Anruf eines besorgten BĂŒrgers errichtete die Polizei Sperren und evakuierte die umliegenden HĂ€user. Ein BombenrĂ€umkommando rĂŒckte an. Der EntschĂ€rfungsroboter nĂ€herte sich dem Aktenkoffer und ... heraus sprang der KnĂŒppel, der dem Roboter derart eins auf die Birne gab, dass seine Elektronik ihr Leben aushauchte. Dann verprĂŒgelte er reihum die Polizisten, Schaulustigen und Kamerateams.
Der Meister lachte, als er es auf seinem Fernseher verfolgte. Der KnĂŒppel bahnte sich nach getaner Arbeit seinen Weg zum Wohnwagen und verschwand im Sack des Meisters. Der fuhr nun zurĂŒck in seinen Wald, nicht ohne vorher den Pass mit dem dummen Namen zu zerreiĂen. Uff!
|
|
|
 |
 |
|
Diese Geschichte wurde von einer hochkarĂ€tigen Jury fĂŒr das âGröĂenwahn MĂ€rchenbuchâ ausgewĂ€hlt.
Eine Rezension auf amazon erwĂ€hnt speziell diese Geschichte: âMein Favorit war die runderneuerte Tischlein deck Dich-Geschichte, sie war stimmig.â
ISBN 3942223309
zu bestellen bei amazon.
Inzwischen (7. Nov. 2014) erschien im GröĂenwahn MĂ€rchenbuch Band 2 ein weiteres MĂ€rchen von mir:
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
Der MâBa-Uch
Ein König lebte mit vier Frauen und vier Söhnen in einem herrlichen Palast, in dem es an nichts mangelte. Zehntausend Diener sorgten fĂŒr das leibliche und seelische Wohl der Herrscherfamilie, und was auch immer diese sich wĂŒnschte â es ward augenblicklich von den Lippen gelesen und erfĂŒllt oder gebracht.
Nun wollte der König, dass die jungen Prinzen etwas vom wahren Leben drauĂen in der Welt kennenlernen sollten.
Er schickte sie also hinaus ins Land, den ersten Sohn nach Westen, den zweiten nach Norden, den dritten nach Osten und den vierten nach SĂŒden.
âWas soll ich im Westen tunâ, fragte der erste Sohn.
âJa, was sollen wir tun?â fragten die anderen Söhne.
âIhr mĂŒsst finden und verstehen, was es hier im Palast nicht gibt.â
âWas soll das sein?â fragten sie wie mit einer Stimme.
âErklĂ€re du es ihnenâ, wandte sich der König an seinen Wesir â er wollte sich nicht anmerken lassen, dass er selbst sich auch nicht so recht auskannte mit dieser Sache.
âIhr mĂŒsst den MâBa-Uch suchen und verstehenâ, war die Antwort des Wesirs.
âUnd was ist der MâBa-Uch?â, kam es wie aus einem Munde.
âWenn ich euch das erklĂ€ren könnte, mĂŒsste euer Vater euch ja nicht auf die Reise schicken. Nein, ich kann euch die Erfahrungen, die zur Erforschung des MâBa-Uch gehören, nicht ersparen.â
So verlieĂen sie den Palast des Vaters und machten sich auf den Weg. Ein jeder in seine Richtung.
Nach langem Wandern erreichte der erste Sohn eine Stadt im Westen und suchte eine Herberge auf. In der Gaststube kam er ins GesprÀch mit einem lustigen, jungen Mann, der ihn nach einiger Zeit fragte, was er denn in der Welt vorhabe.
âIch suche den MâBa-Uchâ, sagte der junge Prinz.
âDen MâBa-Uch?â, fragte der junge Mann. âDen brauchst du doch nicht zu suchen! Der MâBa-Uch ist ĂŒberall. Wir leben vom MâBa-Uch, wir werden regiert vom MâBa-Uch. Der MâBa-Uch ist unser Antrieb, unsere Freude, unser Verlangen und unsere ErfĂŒllung. Der MâBa-Uch ist die Kraft, die unsere Welt zusammenhĂ€lt!â Er zeigte auf sich. Und da ihn ein hĂŒbsches BĂ€uchlein zierte, dachte der junge Prinz, der MâBa-Uch hĂ€tte etwas mit dem Bauch zu tun â was durch die Ăhnlichkeit der Wörter ja auch einsichtig schien. âAber wieso suchst du eigentlich nach dem MâBa-Uch? Hast du denn keinen? Da wirst du hier aber Schwierigkeiten bekommen.â Und er schaute bedeutungsvoll auf das Essen und Trinken, das vor dem Prinzen auf dem Tische stand. Der Wirt, der gerade vorbeiging, rief: âIn meiner Gaststube kriegt der Sohn des Königs keine Schwierigkeiten, sondern â wenn er es mir erlaubt â das Gegenteil davon: MâBa-Uch!â Und die ĂŒbrigen GĂ€ste erhoben ihre GlĂ€ser und riefen: âEs lebe der Sohn des Königs! Es lebe der König! Es lebe der MâBa-Uch!â
Der zweite Sohn lief nach Norden, und lief und gelangte an keinen bewohnten Ort. Als es schon dunkel zu werden begann, erblickte er eine graue, halb zerfallene HĂŒtte am Wegesrand und ging hinein. Wie erschreckte er sich, als die knarrende TĂŒr hinter ihm gegen den Balken schlug! Kaum hatte er sich auf einem Haufen halbwegs trockenen Strohs niedergelassen, hörte er schlurfende Schritte und Gemurmel. Ein faltiges Weib erschien und der Prinz wunderte sich, dass es nicht erschrak, sondern ihn mit zahnlosem Mund ansprach: âWas tut Ihr hier? Was ist Euer Woher und Wohin?â
âIch suche den MâBa-Uchâ, antwortete der junge Prinz.
Die Alte drehte sich erschreckt um, sicherte nach allen Seiten und flĂŒsterte dann: âLeise, die WĂ€nde hier haben Ohren. Es ist gefĂ€hrlich, ĂŒber den MâBa-Uch zu sprechen. Ehâ du dich versiehst, hast du eine Kugel oder ein Messer im Bauch!â
âAber hier ist doch gar niemand auĂer uns beiden, oder?â
âMan kann nie wissen. Vorsicht ist die Mutter der Weisheitâ, murmelte die Alte.
âHeiĂt der MâBa-Uch deshalb so â weil man schnell etwas Schlimmes im Bauch stecken hat?â, fragte der junge Mann.
âNein, mein Junge. Der MâBa-Uch ist sehr sehr alt und niemand weiĂ, warum er so heiĂt, aber die alten Leute sagen, das Wort geht zurĂŒck auf Mâba-ba, das bedeutet nichts anders als Pfui, und UchâĂ€, das heiĂt erst recht Pfui. Aber eigentlich ist MâBa-Uch nur eines von vielen Wörtern fĂŒr die gleiche Sache â Tatsache ist, dass es fast nichts gibt, fĂŒr das es so viele Wörter gibt.â
âWarum ist das so?â, fragte der Prinz.
Die Alte hantierte klappernd mit einem verbeulten Topf und antwortete: âJe weniger es von einer Sache gibt, um so mehr Wörter werden dafĂŒr erfundenâ, und sie lachte laut. âDas ist genau wie beim Schnackern; die MĂ€nner prahlen, wie oft und mit wem sie es getan haben, aber in Wirklichkeit kommen sie nie dazu, es zu tun. Sind stattdessen hinter dem MâBa-Uch her. Hast du es schon getan?â
Der junge Prinz wurde rot, denn er wusste nicht, was die Alte nun genau meinte, den MâBa-Uch oder das andere. Aber er fasste sich ein Herz und fragte: âKannst du mir deinen MâBa-Uch zeigen?â
Die Frau setzte den Topf mit einem Krachen auf den geschwĂ€rzten Stein und rief: âWo denkst du hin? Glaubst du, ich zeige jedem dahergelaufenen Köter meinen MâBa-Uch? Und glaubst du, ich trage ihn bei mir? Nein, ich habe ihn gut versteckt. Wer ihn zeigt, ist ihn schnell los und wer sich zu viel damit beschĂ€ftigt, wird in der Hölle schmoren â sagen die Pfaffen! Ich persönlich glaube das natĂŒrlich nicht!â Sie lachte meckernd in sich hinein. Aber dann lief sie schnell zur TĂŒr hinaus. âMacht mich ganz nervös, das junge Kerlchen; muss dringend nach meinem MâBa-Uch schauenâ, hörte der Prinz noch und war wieder allein.
Sein Bruder stand indessen im Osten vor dem Tor eines wundervollen Parks. In der Ferne erhob sich ein Palast, schöner als alles, was er je in seinem jungen Leben gesehen hatte. Davor standen prĂ€chtig gekleidete Wachen, die ihm freundlich zunickten, jedoch keine Anstalten machten, ihn einzulassen. Da erblickte er durch die GitterstĂ€be des geschmiedeten Tores ein wunderschönes junges MĂ€dchen, das auf einem glĂ€nzenden weiĂen Pferd mit schwarzen Fesseln saĂ und er verliebte sich augenblicklich. Die Schöne kam nĂ€her zum Tor und befahl den WĂ€chtern zu öffnen.
Wie gebannt schaute der junge Prinz zu ihr hinauf.
âWer bist du und was tust du hier?â, fragte sie.
âIch bin der Prinz, der nach Osten geschickt wurde, um den MâBa-Uch zu finden.â
Die WĂ€chter drehten sich zueinander und hielten sich den Bauch. Und auch die schöne Prinzessin â denn um eine solche handelte es sich â lieĂ ein glockenhelles Lachen ertönen.
âDen MâBa-Uch suchst du? Da bist du hier genau richtig!â Sie nahm eine bestickte Tasche von der Schulter und öffnete sie. Heraus flog ein ganzer Schwarm von etwas, das wie bunte Schmetterlinge anmutete, die sich hoch in die LĂŒfte erhoben und in allen Farben schimmerten.
âSiehst du? Das war der MâBa-Uch! Ach was, viele MâBa-Uchs. Sie fliegen in die Welt hinaus und tun Gutes und vermehren sich und befruchten das Land. Viele blĂŒhende Landschaften werden daraus entstehen.â
Der Vierte, jener, der nach SĂŒden wanderte, wurde von einer RĂ€uberbande ĂŒberfallen, splitternackt ausgezogen und von Kopf bis FuĂ durchsucht.
âHer mit dem MâBa-Uchâ rief der RĂ€uberhauptmann.
âEr hat keinen MâBa-Uch, ich habe ĂŒberall gegucktâ, sagte ein RĂ€uber, der so dĂŒnn wie ein Bindfaden war.
Der Hauptmann schrie: âWas heiĂt das, er hat keinen MâBa-Uch? So wie der aussieht und wie er gekleidet ist, mĂŒsste er ĂŒberflieĂen von MâBa-Uch! Hast du ihm in den Hintern geleuchtet?â
âIn den Hintern, in die Ohren, in den Mund und in den Bauchnabel; da ist nichts als schwarze Leere.â
âVerflucht noch eins. Wo willst du hin, ohne auch nur ein bisschen MâBa-Uch?â fragte der RĂ€uberhauptmann.
Der Prinz antwortete: âDas ist es ja gerade â mein Vater, der König, hat mich nach SĂŒden geschickt, damit ich den MâBa-Uch finde.â
Da fingen die RĂ€uber an zu zittern und zu klagen, hĂ€ngten dem armen Prinzen seine Kleider notdĂŒrftig ĂŒber den Körper und flehten: âVerratet uns nicht, wir sind nur arme RĂ€uber und haben es nicht böse gemeint. Wir tun alles fĂŒr Euch, wenn Ihr uns nur am Leben lasst.â
Sie knieten vor ihm nieder, wĂ€lzten sich im Staub der StraĂe und machten PurzelbĂ€ume rĂŒckwĂ€rts, um sich unauffĂ€llig zu entfernen.
âHalt!â, rief der Prinz, âihr mĂŒsst mir sagen, was der MâBa-Uch ist. Ich muss es wissen!â Und er wollte hinter ihnen her rennen, wobei er aber seine Kleider wieder zu verlieren drohte. Also blieb er stehen.
WĂ€hrend sie weiter purzelten, riefen die RĂ€uber: âMach dir nicht die Finger am MâBa-Uch schmutzig. Der MâBa-Uch ist des Teufels, das Böseste des Bösen! Du hast ja gemerkt, was wir dir um seinetwillen angetan haben. Beinahe hĂ€tten wir dich getötet.â Und damit verschwanden sie in GebĂŒsch und hinter BĂ€umen.
Als sie wieder zu Hause waren, stritten die vier Prinzen im Palast ihres Vaters ĂŒber ihre Erfahrungen und gingen aufeinander los, denn sie konnten keine Einigung darĂŒber erzielen, was der MâBa-Uch sei und wie man ihn zu behandeln habe.
Der Wesir kam gerade noch rechtzeitig hinzu, bevor sie sich gegenseitig umbrachten.
âWer von uns hat den wahren MâBa-Uch gefunden? Entscheide du!â riefen sie.
Der Wesir hieĂ sie im Garten niederknien, jeden der vier im Angesicht einer Rosenknospe. Es wurde heller Tag und die RosenblĂŒten öffneten sich.
Es wurde Abend und die Sonne versank hinter dem Horizont.
Es wurde dunkel.
Als der Vollmond leuchtend hinter den TĂŒrmen des Palastes aufstieg, wussten sie die Antwort. Doch erst am nĂ€chsten Morgen gingen sie lachend und weinend auseinander, als Geschwister fĂŒr immer vereint.
|
 |
|
|
 |
 |
 |
|
Sie hat es wieder getan
Charlie wacht so halb auf â nein eher nur ein viertel â und ihm brummt der SchĂ€del.
Eine durchzechte Nacht.
Wie ist er ins Bett gekommen?
Seine Hand tastet nach der Tussi neben ihm, aber da ist niemand.
GlĂŒck gehabt, ist wohl gegangen.
Charlie wankt aufs Klo, dabei muss er sich festhalten.
Aus dem Augenwinkel sieht er, wie sein Spiegelbild sich bewegt, einmal im Badezimmerspiegel, einmal im Spiegelschrank an der Wand. BloĂ nicht hinschauen, ich sehe bestimmt furchtbar aus.
Stehen beim Pinkeln? Zu gefĂ€hrlich â ich könnte umkippen.
Also hinsetzen. Jetzt mache ich's mal so, wie die dummen Weiber es mir immer unterjubeln wollen. Wie sich das anfĂŒhlt ... als wĂ€re man kein Mann ...
Die Kuh von gestern, das war eine Nacht ... was habe ich ĂŒberhaupt mit ihr angestellt? Ich kann mich an nichts erinnern! Habe ich sie gevögelt? Konnte ich noch? Ich kann immer!
Wie sind wir eigentlich hierhergekommen? Bin ich etwa auf meiner MĂŒhle gefahren, mit der Alten hintendrauf?
Er wankt zum Fenster.
Obercool, die Harley steht unten, brav angekettet an der Kellertreppe.
Er taumelt zurĂŒck zum Bett, die Beine wollen nicht richtig, das Kreuz tut weh.
Dann merkt er, dass er noch tröpfelt. Morgendliche Inkontinenz â ScheiĂe.
Da liegt ein Zettel auf dem Kopfkissen, kann man nicht lesen, die Schrift ist so verschwommen. Er muss die Augen ganz schön zusammenkneifen: "Ich habe mir ĂŒberlegt, dass wir uns nicht mehr sehen sollten. Du weiĂt schon, der Altersunterschied. "
Verstehe ich nicht. Ălter als fĂŒnfundzwanzig kann sie doch wohl nicht gewesen sein. Egal. Erst noch mal ne Runde pennen.
Lange Zeit spĂ€ter nimmt er noch mal den Zettel zur Hand, kneift die Augen zusammen. Was ist mit meinen Augen? Seine HĂ€nde zittern. Die HĂ€nde, die HĂ€nde. Er schaut genauer auf seine HĂ€nde. Ganz schön faltig, meine HĂ€nde. Und diese Flecken, braune Flecken ĂŒber und ĂŒber.
Irgendwas ist hier ganz und gar nicht in Ordnung.
Zwischen den Beinen juckt es ihn.
Er will kratzen â und â
da ist â nichts.
Er reiĂt sich den Schlafanzug vom Leib und schaut sich an. Sieht einen Frauenkörper.
Viel schlimmer, einen alten, verbrauchten Frauenkörper.
Zwischen den Beinen: gĂ€hnende Leere, umrandet von weiĂen Haaren. Der absolute Horror.
Er will aus dem Bett springen, kann nicht, denn er ist schwer und steif und gebeugt und behindert.
Er schleppt sich ins Badezimmer und jetzt schaut er endlich in den Spiegel und sieht ein steinaltes Gesicht voller Falten, umrahmt von zotteligen weiĂen Haaren.
Ein schrecklicher Traum. Am besten noch mal hinlegen. Wenn ich wieder aufwache, ist alles okay.
Aber nichts ist okay. Charlie hat sich in eine uralte Frau verwandelt.
Aber so was gibt's ja doch nicht, oder? Er hat eine Idee: "Da hat mir einer eine Wahnsinnsdroge untergejubelt, gestern in der Disco. Da war so ein Arsch mit teuren kleinen Pillen."
Also abwarten. Wieder einpennen. Aber er kann nicht mehr pennen. Die Gedanken in seinem Kopf drehen sich im Schleudergang.
Vielleicht um endlich aufzuwachen aus diesem schrecklichen Alptraum, kneift er sich, erwischt die Brust. Das tut weh. Gibt es eine gröĂere Peinlichkeit, als einer SechzigjĂ€hrigen an die Titten zu greifen?
Es muss was geschehen. Aber was?
Charlie zwÀngt sich in seine Motorradkluft.
Der Busen behindert ihn. Dieser hÀssliche, obszöne Busen!
Er bemerkt den Geruch, der seiner Haut entströmt: saure, verfaulte Gurken mit dem Haut-gout von KreuzkĂŒmmel und gammeligem SchwarzwĂ€lder Schinken.
Ich muss jemanden finden, der mir hilft.
Auf seinem Motorrad fĂ€hrt er zum Krankenhaus. Wenigstens das Fahren fĂŒhlt sich einigermaĂen normal an. Der Wind zaust seine unterm Helm hervorquellenden, ungekĂ€mmten Haare.
Der Doktor schaut ihn mit groĂen Augen an.
"Wobei soll ich Ihnen helfen?"
"Ich muss von meinem Trip runter."
"Welcher Trip?"
"Der Trip, der Trip!"
Charlie will aufspringen und auf den Doktor losgehen. Sein ganzer Körper schmerzt, er ist mĂŒde, die HĂŒften tun weh, die Knöchel, die Knie.
"Man hat mir eine Droge verpasst. Ich fĂŒhle mich wie eine sechzigjĂ€hrige Frau."
"Dann geht es Ihnen doch wunderbar, denn nach meiner SchĂ€tzung mĂŒssen Sie hoch in den Siebzigern sein."
"Ich bin zwanzig, Mann! Zwanzig!"
Des Doktors Blick irrlichtert ĂŒber seinen Schreibtisch. Er ergreift einen Jadeelefanten und dreht ihn zwei- dreimal in der Hand. Dann schaut er Charlie an: "Sie sehen aber aus wie fĂŒnfundsiebzig oder gar achtzig. Was weiĂ ich? Haben Sie Ihren Personalausweis dabei?"
Charlie kann nicht mehr sprechen. Er schaut den Arzt nur mit weit aufgerissenen Augen an.
Der steht auf, holt ein LĂ€mpchen aus der Brusttasche, zieht die Lider auseinander, leuchtet Charlie in die Augen.
"Greisenbogen. Normal in Ihrem Alter."
Er hört Charlie ab, klopft auf seinen RĂŒcken, prĂŒft die Reflexe. Charlie lĂ€sst alles ĂŒber sich ergehen.
Der Arzt murmelt wie zu sich selbst: "Blutdruck leicht erhöht â Arthrose in den Knien. Reflexe altersbedingt reduziert, möglicherweise beginnende Polyarthritis. Aber Sie werden wahrscheinlich an AltersschwĂ€che sterben, bevor sich die so verschlimmert, dass Sie damit Probleme kriegen. Ich könnte Ihnen Cortison verschreiben. Haben Sie Schmerzen in den HĂ€nden?"
Charlie schreckt hoch. Schaut den Arzt mit irrem Blick an.
Der setzt sich wieder hinter seinen Schreibtisch. "Ich glaube ich kann nichts weiter fĂŒr Sie tun. Ihr körperlicher Zustand ist exzellent fĂŒr Ihre Jahre. Wir können natĂŒrlich noch den einen oder anderen Test machen ..."
Nein! Ich will nach Hause. Charlie tĂŒrmt.
SchmeiĂt wie in Trance sein Motorrad an. Beinahe baut er einen Unfall.
Zu Hause sitzt er auf dem Bett, starrt ins Leere. Der SchlĂŒssel dreht sich im Schloss.
Charlies GroĂneffe kommt nach Hause.
"Tante Charlie, was machst Du denn hier?
Ist es wieder passiert?
Und den Zettel hast du auch gelesen! WeiĂt du wer den geschrieben hat? Meine ehemalige Lehrerin. Sie meint, weil sie achtundreiĂig ist und ich zwanzig, dĂŒrfen wir es nicht mehr tun.
Ich bin ganz schön sauer."
Er geht zum Telefon: "Hallo? Ja, meine GroĂtante ist hier. Sie hat es wieder getan. Je oller je doller. Hat meine Klamotten an, ist mit meinem Motorrad gefahren etcetera, die ĂŒbliche Geschichte. Nein, den will ich ihr nicht wegnehmen, ich bin ja im Grunde froh, wenn ich weiĂ, da ist jemand, der noch einen SchlĂŒssel hat.
Ich bringe sie. Komm, Tante Charlie. Wir fahren ins Heim."
Tante Charlie steht auf, strafft sich. Hat sich ein Gel geschnappt und streicht es sich mit festem Griff in die Haare. Im Profil, gegen das helle Licht des Fensters, könnte man sie einen Moment lang wirklich fĂŒr zwanzig halten.
"Das Zeug ist gut, wĂŒrdest du mir das mal leihen?", fragt sie.
"Klar Tante."
Diese Geschichte hat einen kleinen Preis bei einem Wettbewerb im "LizzyNet" gewonnen.
Die Juroren schrieben: "Eine richtig gute Geschichte - vor allem der ĂŒberaus gelungene Twist am Ende hat begeistert".
|
|